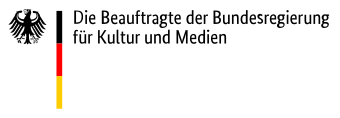Pressemitteilung, 16. April 2024
Angesichts der aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen startet der Bundesverband Soziokultur gemeinsam mit seinen Landesverbänden die Kampagne „Wir leben Demokratie!“ zur Stärkung der Demokratie und Vielfalt in Deutschland. Gerade jetzt ist es wichtig, die zentrale Rolle soziokultureller Zentren und Initiativen in der Aufrechterhaltung demokratischer Prozesse herauszustellen. Denn sie sind wichtige Freiräume für den Dialog und für zivilgesellschaftliches Engagement.
Soziokultur lebt in allen Bereichen demokratische Werte, sei es in der niedrigschwelligen Vermittlungs-, Bildungs- und Kulturarbeit, die Interessierte zum Mitgestalten einlädt, sei es als Orte gelebter Demokratie in den Arbeitsstrukturen.
„Soziokultur schafft Räume für vielfältigen, gleichberechtigten Austausch und gesellschaftliche Integration. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen motiviert werden, auch außerhalb dieser Räume ihre Stimme einzubringen“, erklärt Kristina Rahe, Referentin für Demokratiestärkung des Bundesverband Soziokultur. „Denn es geht schließlich darum sicherzustellen, dass möglichst viele erkennen, wie wertvoll es ist, sich in demokratische Prozesse einzumischen.“
Die Kampagne „Wir leben Demokratie!“ unterstreicht die tiefgreifende Wirkung soziokultureller Praktiken bei der Förderung von Vielfalt, Gleichheit und aktivem gesellschaftspolitischem Engagement. Sie zielt darauf ab, die Stimmen und Aktivitäten derjenigen zu verstärken, die sich in ihrer alltäglichen Arbeit für demokratische Grundsätze einsetzen, so wie es die Akteur*innen in soziokulturellen Zentren und Initiativen tun.
In seinem Positionspapier zur Demokratiestärkung stellt der Bundesverband die Wichtigkeit der Soziokultur heraus und fordert die Politik zur angemessenen Unterstützung auf.
Der Bundesverband ruft Einzelpersonen und Organisationen im ganzen Land dazu auf, sich der Kampagne „Wir leben Demokratie!“ anzuschließen, indem sie ihr Engagement für die Demokratie sichtbar machen.
„Zeigen wir, dass und wie die Demokratie durch unsere gemeinsamen Anstrengungen weiterhin gedeiht“, wünscht sich Kristina Rahe. „Gemeinsam setzen wir ein Ausrufezeichen gegen Rassismus und Populismus und treten für eine Gesellschaft ein, die Diversität und Gleichberechtigung begrüßt.“
___________________________
Kontakt: Barbara Bichler | Barbara.Bichler@soziokultur.de | 0176 45 75 66 88
Der Bundesverband Soziokultur ruft angesichts der gesellschaftspolitischen Entwicklungen dazu auf, gemeinsam und sichtbar ein Ausrufezeichen für Demokratie und Vielfalt zu setzen. Wir positionieren uns klar und deutlich: Wir treten für die Demokratie ein, in all unserem Schaffen!
Für eine offene, pluralistische Gesellschaft braucht es offene Orte der Gemeinschaft
Schnell, unkompliziert und mit weit geöffneten Türen schafft es die Soziokultur über Kunst und Kultur, Menschen aller Altersgruppen in Verbindung und in den Dialog zu bringen – unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen oder politischen Hintergrund.
Soziokulturelle Zentren und Initiativen stehen schon jetzt nicht nur in Sachsen, Brandenburg und Thüringen im Fokus rechtsextremer Anfeindungen. Wir sagen deutlich: Diese Orte müssen als Freiräume erhalten bleiben, als belebende Orte der Gemeinschaft, Experimentierfelder für Engagement und gesellschaftspolitische Auseinandersetzung. Gerade jetzt braucht es diese Räume für Begegnung, an denen es möglich ist, gemeinsam soziale Anliegen zu diskutieren und Lösungen für ein gutes Zusammenleben zu finden. All das ist genuin für eine offene und pluralistische Gesellschaft.
Vielfalt bedeutet Kraft und gleichberechtigte Teilhabe
Ob mit kollektiven Führungsmodellen, Strukturen auf Ehrenamtsbasis, der gleichwertigen Anerkennung unterschiedlicher Kulturformen oder der Beteiligung aller – die Soziokultur lebt Demokratie in all ihren Arbeitsfeldern. Kulturelle Vielfalt und Selbstbestimmung, das Experimentieren und Neuentwickeln stehen im Vordergrund und bereichern gegenseitiges Verständnis. In den soziokulturellen Zentren wird eine Gestaltung der Gesellschaft alltäglich erprobt und gelebt – ein idealer Startpunkt für alltägliches politisches Engagement.
Soziokultur schafft gesellschaftliche Integration und Diversitätsorientierung – oftmals ohne dies explizit zu benennen, denn das Grundsatzmotto „Kultur von allen für alle“ kennt keine Exklusion: Alle sind gleichwertig als Beteiligte einbezogen, sind als Nutzer*innen der Kulturorte eingeladen, als Macher*innen statt ausschließlich als Publikum in Erscheinung zu treten. Statt eine Gesellschaft der Singularitäten zu befördern, lebt die Soziokultur Pluralität und ist damit Role Model einer toleranten Gemeinschaft.
Demokratie braucht eigenes Erleben und Selbstwirksamkeit
Durch Beteiligungsformate, die Veränderungen im Umfeld der Mitwirkenden fassbar machen, erleben sich Menschen im Rahmen soziokultureller Aktivitäten als gestaltende Kraft ihrer Alltagsräume. Diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit überträgt sich auch auf weitere demokratische Prozesse. Die Gestaltungskraft und Freude am gemeinsamen Handeln verdeutlichen, wie Engagement direkt und sichtbar wirkt – und wie viel Freude darin steckt.
Soziokulturelle Demokratiearbeit braucht verlässliche Rahmenbedingungen
Die Stärkung der Demokratie durch zivilgesellschaftlich organisierte Kulturarbeit wird umfänglich durch diverse soziokulturelle Zentren und Initiativen und ihre engagierten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden umgesetzt. Wenn sie niedrigschwellig bleiben und in die Breite wirken will, reicht eine eigen erwirtschaftete Finanzierung allein durch Eintritte, Vermietungen oder Kursgebühren jedoch nicht. Über eine verbal oft betonte symbolische Wertschätzung hinaus ist eine dauerhafte, verlässliche und nachhaltige Förderung der soziokulturellen Strukturen unabdingbar. Fragen zur Demokratiestärkung sind immer auch Fragen zu einer nachhaltigen Finanzierung der soziokulturellen Zentren und Initiativen. Wir fordern soziokulturelle Zentren als selbstverständlichen Bestandteil der kulturellen Infrastruktur von Gemeinden in Stadt und Land.
Ein gemeinsames Ausrufezeichen: Kampagne zur Demokratiestärkung
Der Bundesverband und seine Landesverbände starten eine gemeinsame Kampagne, die herausstellt, wie kraftvoll die Demokratiearbeit in den soziokulturellen Zentren und Initiativen umgesetzt wird. Alle Akteur*innen der Soziokultur und darüber hinaus sind eingeladen zu zeigen, wie sie in ihrem Alltag, in ihrer Arbeit, in ihrem Engagement tagtäglich Demokratie leben.
Für alle diejenigen, die ein Ausrufezeichen setzen und sichtbar machen wollen, wie sie sich für Demokratie einsetzen, stellt der Bundesverband in Kooperation mit seinen Landesverbänden Materialien zur freien Nutzung zur Verfügung. Mit dieser gemeinsamen Kampagne möchten wir zeigen: Wir alle leben und lieben die Demokratie, wir glauben an sie als die freiheitliche Gesellschaftsform und setzen uns für sie ein. Rassismus und Verfassungsfeindlichkeit haben keinen Platz!
Man muss sich Nürnberg als gediegene Stadt vorstellen, in die 1973/74 jäh der Ungeist der neuen Zeit hineinfuhr: Als im alten Künstlerhaus in zentraler Lage am Bahnhof ein „Kommunikationszentrum“ einzog, das bald alle nur noch KOMM nannten, fürchteten nicht wenige Einwohner mit freundlicher Unterstützung der lokalen CSU um die bürgerliche Kultur Mittelfrankens. Mit dieser hatte das KOMM denkbar wenig im Sinn. Im Gegenteil: Kultur, wie dieses Zentrum sie betrieb, war all das, was die etablierten Kulturorte nicht haben wollten: Gegen-, Jugend- und Subkulturen, und überhaupt alle möglichen Formen und Veranstaltungen, die mit der Kultur der städtischen Museen, Konzerthäuser und Theater nichts bis gar nichts gemein hatten.
„LSD – Lieder, Songs und Diskussionen“ im KOMM
Hier gab es Tanz und Theater jenseits der Konvention, Handwerk, schrille Musik, die in den Ohren schmerzte, politische Veranstaltungen mit Titeln wie „LSD – Lieder, Songs und Diskussionen“, alternative Film- und Fotoprojekte, Senioren- und Migrantentreffs. Hier trafen sich haufenweise junge Menschen, die sich, statt auf gepolsterten Konzertsesseln zu sitzen und zuzuhören, lieber auf Treppenstufen herumfläzten und die Nacht durchdiskutierten. Und dann die langen Haare, ordinären Klamotten und der süßliche Duft selbstgedrehter Tüten… Dass das Ganze nicht obrigkeitlich gelenkt, sondern selbstverwaltet war, machte es nicht besser.
Offen für alle und alles und obendrein direkt am Bahnhof
Das KOMM war offiziell eine „städtische Dienststelle besonderer Art“. Konkret hieß das: Die Stadt verlangte keine Miete, zahlte Zuschüsse und trug die Verantwortung, ließ gleichzeitig aber die jungen Leute um den Kunstpädagogen Michael Popp weitgehend machen. Da man offen für alle und alles und obendrein direkt am Bahnhof war, sammelten sich um das KOMM nicht nur Künstler, sondern viele gesellschaftliche Randgruppen wie Anarchisten, Junkies oder Obdachlose, weshalb es immer mal wieder krachte und zuweilen die Polizei zugriff. Der Ruf war bald ruiniert bzw. etabliert, „weil die da drin hashen und so“, wie ein Nürnberger Mädchen zu berichten wusste. Kurzum: Die Kultur, die sich hier zeigte, passte weder ästhetisch noch sozial zu dem, was ein Großteil des Bürgertums vor 50 Jahren zu akzeptieren bereit war. Kultur als das „Wahre, Schöne und Gute“ jedenfalls stellte es sich deutlich anders vor.
Der Untertitel des kulturpolitischen Manifests „Die Wiedergewinnung des Ästhetischen“ enthielt das Schlagwort, das von da an einer alternativen Kulturpolitik ihren Markennamen geben sollte: „Perspektiven und Modelle einer neuen Soziokultur“.
Dass das KOMM ausgerechnet im erzkonservativen Bayern des CSU-Landesverwesers Alfons Goppel entstehen konnte, lag vor allem an Nürnbergs Kulturreferenten Hermann Glaser, 46 Jahre alt, SPD. Glaser war einer der großen Kulturvisionäre der Bundesrepublik und Ideengeber hinter dem KOMM. Pünktlich zu dessen Eröffnung brachte er 1974 zusammen mit dem Medienwissenschaftler Karl Heinz Stahl das kulturpolitische Manifest „Die Wiedergewinnung des Ästhetischen“ auf den Markt. Der Untertitel enthielt das Schlagwort, das von da an einer alternativen Kulturpolitik ihren Markennamen geben sollte: „Perspektiven und Modelle einer neuen Soziokultur“.
Soziokultur im Kontext der Neuen Sozialen Bewegungen
Soziokultur: Das war einerseits eine kulturelle Praxis, eine bestimmte Art, Kunst und Kultur zu machen: freies Theater im öffentlichen Raum, selbstverwaltete Clubs und Programm-Kinos, Kunstaktionen in alten Fabrikhallen, Frauenarchive oder Kulturarbeit mit Jugendlichen und Migranten. Solche alternativen Ästhetiken und Kulturprojekte jenseits des Bürgerlichen gab es schon länger: in der Bohème und den Avantgarden, in den Sezessionen und der reformpädagogisch inspirierten Kunstpädagogik um 1900 und in der DDR. Aber erst im Kontext der Neuen Sozialen Bewegungen um und nach 1968 trafen sie in Westdeutschland auf eine Gesellschaft, die sich langsam dafür zu öffnen begann und auf Politiker, die dafür Geld bereitstellten.
So wertete die Soziokultur Kulturformen auf, die bis dato einem bildungsbürgerlich geprägten Publikum als minderwertig galten und erschütterte den Kanon der Hochkultur.
Jetzt entwickelte sich Soziokultur zu einem (linken) politischen Programm, das die Theorie zur Praxis lieferte und bestrebt war, die in Jahrhunderten mühsam dem Alltag enthobene deutsche Kultur wieder zurück auf die Erde zu bringen. Soziokultur wollte das, was als Kultur galt und wofür Kultur zuständig sein sollte, grundlegend neu definieren: Diese Kultur war nicht mehr rein aufs Ästhetische reduziert, exklusiv auf ästhetisch gebildete Kulturbürger und hauptberufliche Künstler zugeschnitten, und sie strebte auch nicht nach Distinktion, um sich von anderen Schichten abzugrenzen. Statt dessen war sie denkbar breit angelegt, akzeptierte Laien-, Breiten- und Populärkultur, die das Kulturestablishment mit hoch gezogenen Augenbrauen wacker ignorierte. So wertete sie Kulturformen auf, die bis dato einem bildungsbürgerlich geprägten Publikum als minderwertig galten und erschütterte den Kanon der Hochkultur.
Rubrum „Kultur für alle“
Freilich war sie ähnlich beseelt von der Idee einer Erziehung des Menschen durch Ästhetik wie das Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts, denn Soziokultur wollte Gesellschaftspolitik betreiben: „Im Mittelpunkt soziokultureller Bildungsarbeit“, postulierten Glaser und Stahl, „hat die Erziehung zur Politik zu stehen, zur Fähigkeit, Umwelt reflektierend wahrnehmen und agierend gestalten zu können.“ Nur so könne der Mensch sich in die Gesellschaft einbringen, nur so sei er befähigt zu politischer Teilhabe: „Der Wiederherstellung der Politik muß die Wiederherstellung des Ästhetischen zur Seite treten, damit die weitgehend vernachlässigten oder zerstörten Voraussetzungen für menschliches Zusammenleben rekreiert werden. Kultur soll die Augen öffnen, die Welt so zu erleben, wie sie ist, und zugleich die Welt gestalten helfen, wie sie sein sollte.“ Damit war der gleichermaßen an Schiller wie an Kritischer Theorie geschulte Ton gesetzt für das Programm einer „Neuen Kulturpolitik“, das der Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann unter dem Rubrum „Kultur für alle“ weiter ausbuchstabieren sollte.
Die Soziokultur verschob die Wertkriterien von der bürgerlichen Ästhetik zur sozialen Wirkung in der Gesellschaft.
Soziokultur war nahbar und in der Mitte des Lebens mit all seinen Problemen angesiedelt. Ästhetik galt ihr als Mittel zum politischen Zweck, nicht als Selbstzweck. Dem Anspruch nach „demokratisch“, sollte Soziokultur alle Menschen (und nicht nur eine kleine Elite von Kennern und Könnern) beteiligen und sie zu selbständiger kreativer Arbeit anleiten. So wollte sie die Bürger sensibler und empfindsamer machen, auf dass sie sich in die Politik einmischten, weil sie sich ihrer Bedürfnisse bewusst waren und diese künstlerisch und verbal artikulieren konnten. Von der Idee einer vermeintlich unpolitischen Kunst in Namen eines alltagsfernen „interesselosen Wohlgefallens“ (Kant) war das denkbar weit entfernt. So verschob Soziokultur die Wertkriterien von der bürgerlichen Ästhetik zur sozialen Wirkung in der Gesellschaft.
Sie verstand und versteht sich bis heute als engagiert, inhaltlich vielfältig, basisdemokratisch organisiert, gemeinnützig, partizipativ und pocht auf permanente „Transformation“, um agil zu bleiben.
Das entsprach so ziemlich genau dem Gegenteil von „affirmativer Kultur“. Mit diesem Begriff hatte der marxistische Philosoph Herbert Marcuse seinerzeit die dominante bildungsbürgerliche Kultur belegt. Ihr warf er vor, den Menschen von seinem vermeintlichen Elend – seiner „Entfremdung“ im arbeitsteilig organisierten Kapitalismus – abzulenken und zu versuchen, die Bevölkerung mit dem herrschenden System zu versöhnen (daher affirmativ), statt sie zu befähigen, ihre prekäre Lage zu erkennen und dagegen aufzubegehren. Soziokultur wollte genau das: Bewusstsein schaffen, die Menschen aufrütteln und wach machen, sie gegen politische Apathie und Desinteresse wappnen. Soziokultur, das war „Phantasie statt Lethargie“, wie es in großen Lettern auf einer Wand im KOMM stand. Sie verstand und versteht sich bis heute als engagiert, inhaltlich vielfältig, basisdemokratisch organisiert, gemeinnützig, partizipativ und pocht auf permanente „Transformation“, um agil zu bleiben.
Kulturarbeit ist (auch) Gesellschaftspolitik
Damit war und ist sie überaus erfolgreich. Werte wie Teilhabe, kulturelle Bildung, die Öffnung zur Alltagskultur oder Diversität, für die Soziokultur früh einstand, sind längst als politische Imperative ins Pflichtenheft der etablierten Museen, Theater und Konzerthäuser eingegangen. Was vor 50 Jahren unerhört war, wird heute mit großer Selbstverständlichkeit bejaht (wenngleich nur bedingt umgesetzt): Kulturarbeit ist (auch) Gesellschaftspolitik. Dieses Umdenken ist freilich nicht allein Verdienst der Soziokultur, sondern folgte einer Verschiebung, die sich international seit den 1970er Jahren vollzieht, in diversen UNESCO-Erklärungen abbildet und in Großbritannien im Mantra der Social Inclusion wohl am tiefsten ins Kultursystem eingeschrieben hat. Eine solche „Transformation“ treibt heute eine neoliberale Politik weiter voran, die Kultur an ihrer „gesellschaftlichen Relevanz“ misst. Sie hat sich auch vormals rand- und widerständige Kulturformate einverleibt.
Die symbolische Anerkennung für die Soziokultur ist also da, die materielle in der Regel nicht.
Soziokultur ist inzwischen weniger ein eigenständiges Reformprogramm jenseits des Staates, sondern etliche ihrer Theatergruppen, Kinos und Zentren, die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit oder die Geschichtswerkstätten haben sich in den etablierten Kulturbetrieb hineingearbeitet. Sie sind Teil der kommunalen und staatlichen Kulturförderung geworden. Die symbolische Anerkennung ist also da, die materielle in der Regel nicht. Das Gefälle zur etablierten Hochkultur ist unübersehbar: Im Vergleich zu dieser bewegen sich die Zuwendungen für Soziokultur aus Steuergeldern im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Nur jede zehnte Stelle hier ist unbefristet und sozialversicherungspflichtig. Viele arbeiten ehrenamtlich, prekär oder in Teilzeit. Die Hälfte des Umsatzes muss Soziokultur im Schnitt selbst erwirtschaften, in der Regel aus befristeten Projektmitteln. Langfristig abgesicherte Arbeit ist so kaum möglich. Deshalb verbuchte es die Szene als großen Erfolg, dass Hessen seine jährliche Förderung für Soziokulturzentren seit 2016 auf mittlerweile fast 2 Mio. Euro vervierfacht und auf langfristige Strukturförderung umgestellt hat.
Kultur ist mit ihr definitiv schichtübergreifender, unkonventioneller und bunter geworden.
Der Argwohn der etablierten Kulturinstitutionen ist der Soziokultur damit sicher, schließlich konkurriert man um dieselben Gelder. Übel genommen wird ihr auch, dass sie den vormals so schön klaren Kanon an förderungswürdiger (Hoch-)Kultur ausgedehnt und die ästhetisch begründeten Qualitätsmaßstäbe des Bildungsbürgertums aufgeweicht hat. Kultur ist mit ihr definitiv schichtübergreifender, unkonventioneller und bunter geworden. Damit trug sie aber auch ihren Teil bei zu postmoderner Beliebigkeit, die neben Nutzen auch Orientierungsverlust stiftete.
Und in Zukunft?
Nach 50 Jahren stehen viele soziokulturellen Projekte nun vor einem Umbruch. Die Generation der Gründer und frühen Mitstreiter tritt ab, Nachfolger sind nicht immer in Sicht. Wo die öffentliche Hand nicht übernimmt, werden sich die Reihen lichten – selbst wenn die Lücken groß sein könnten. In Nürnberg wurde das KOMM bereits 1996 geschlossen, nachdem die CSU die Stadtregierung übernommen und sich mit dem Zentrum auf keine Zusammenarbeit einigen konnte. Das ehemalige Künstlerhaus firmiert heute zusammen mit anderen kommunalen Einrichtungen unter dem Namen KunstKulturQuartier. Es ist weiter ein lebendiger Ort der freien Szene. Selbstverwaltung und Subkulturen allerdings hat es hier hinweggerafft.
———————————
Thomas Thiemeyer ist Professor für Empirische Kulturwissenschaft am Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen
Dieser Beitrag wurde erstveröffentlicht am Samstag, den 23. März 2024 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Nr. 71
“Let’s continue to work together to build strong alliances to find collective strength to contribute to global action for climate!”
NEMO, Network of European Museum Organizations
Ökologische Standards bieten eine Orientierung
Eigentlich wissen es alle – eine betriebsökoklogische Ausrichtung wird künftig Standard sein. Viele soziokulturelle Zentren und Initiativen sind bereits auf dem Weg, manche fragen sich, womit sie beginnen sollten, andere wünschen sich ein Feedback zu ihren Anstrengungen in der Betriebsökologie. Standards geben einen Rahmen vor und damit Orientierung. Ein Mindeststandard enthält Maßnahmen, die niederschwellig sind, mit wenig Aufwand umzusetzen und von vielen bereits eingehalten werden. Ein Abgleich des eigenen Handelns mit einem Standard hilft dabei, sich selbst einzuschätzen und neue Ziele zu setzen.
Auf bestehendem aufbauen
Ob Veranstaltungen, Film, Festival, Konzerte oder die Gastronomie – es gibt für jeden Kulturbereich anerkannte Leitfäden. Die Soziokultur braucht also keinen eigenen Standard mit zusätzlichen Parametern, sondern eine kluge Zusammenstellung des Bestehenden. Daran arbeitet das Team des Bundesverband Soziokultur im Rahmen des Projektes zur Entwicklung ökologischer Mindeststandards (ÖMI).
Netzwerken
Das Projektteam befindet sich im Austausch mit anderen Verbänden, die ähnliche Prozesse bereits umgesetzt haben oder sie noch anstoßen werden, darunter sind Zukunft feiern e. V., der Deutsche Museumsbund e. V., der BUND Berlin und der Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V.. Dabei steht das voneinander Lernen und die gegenseitige Unterstützung im Vordergrund, denn die Umsetzung von betriebsökologischen Maßnahmen betrifft sämtliche Kultursparten und Kultureinrichtungen.
Am Beispiel Theater Green Book: Eine Anregung zum Starten – und Dranbleiben
Das Theater Green Book beschreibt Standards für die nachhaltige Theaterproduktion in drei Stufen. Die Basisvariante entspricht einem Mindeststandard und enthält Maßnahmen zur Etablierung von Managementstrukturen. Ansatz hier: Niederschwellig, machbar, kostengünstig, mit wenig externem Fachwissen umsetzbar. Die Fortführung der ökologischen Ausrichtung erfolgt in der „advanced“-Version. Sie erfordert mehr strategische Planung, Budget und qualifiziertes Personal. In der „Spezial-Variante“ geht es z.B. um die Schließung von Stoffkreisläufen, die CO2-Bilanzierung sämtlicher Aktivitäten und die konsequente Kooperation mit Anbietern nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen.
An diesem mehrstufigen Ansatz orientiert sich auch das Projekt ÖMI mit dem Ziel, dass Kultureinrichtungen Veränderungsprozesse beginnen – und dranbleiben.
Soziokulturelle Zentren sind Orte, an denen Wert darauf gelegt wird, alle zum Dialog, zum Miteinander und zum gemeinsamen wirken zusammenzubringen. Sie sind lebendige Orte der Gemeinschaft, an denen jede und jeder durch Kunst und Kultur Sichtbarkeit, Gehör und Teilhabe erfahren kann. Soziokultur und die Initiative Offene Gesellschaft arbeiten entsprechend an gleichen Zielen: Durch Teilhabe und Dialog die Demokratie für eine offene, gerechte und vielfältige Gesellschaft für alle zu verbessern.
Die Initiative Offene Gesellschaft
Die Initiative Offene Gesellschaft verbindet Bürger*innen, Akteure der Zivilgesellschaft und politische Institutionen mit innovativen Formaten und etabliert neue Räume für Dialog und Partizipation. So soll der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt, zukunftsfähige Ideen und vielfältige Perspektiven entwickelt werden.
Der Bundesverband Soziokultur unterstützt die Initiative Offene Gesellschaft und lädt soziokulturelle Zentren ein, auch am Tag der offenen Gesellschaft mit eigenen Aktionen mitzuwirken.
Tag der offenen Gesellschaft
Seit 2017 organisiert die Initiative Offene Gesellschaft jährlich im Juni den „Tag der offenen Gesellschaft“. Unter dem Motto „Tische und Stühle raus” veranstalten Menschen und Einrichtungen überall in Deutschland Austauschformate, um miteinander ins Gespräch zu kommen, einen Raum für Begegnungen zu schaffen und ein Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt zu setzen. Auch viele soziokulturelle Zentren beteiligen sich am Tag der Offenen Gesellschaft: als Orte des Austausches, der kulturellen Vielfalt und der Meinungsfreiheit.
2024 findet der „Tag der offenen Gesellschaft“ am Samstag, den 15. Juni 2024 statt.
Wie spreche ich das Publikum von morgen an? Wen erreiche ich aktuell, wen würde ich gerne beteiligen? Welche Transformationsprozesse sind notwendig, damit das Zielpublikum (wieder)kommt und sich eine solide Community entwickelt? In einem auf eure Bedürfnisse zugeschnittenen internationalen Trainingsprogramm vermitteln wir die Kompetenzen, die für einen nachhaltigen Communityaufbau wichtig sind, und begleiten euch auf dem Weg von der Theorie zur Praxis. Bewerbungen zur Teilnahme sind bis 22. April möglich.
„Make it happen: Community Building and Audience Development for the Future” – Das Trainingsprogramm für Kulturinitiativen.
Sparzwang, gestiegene Erwartungshaltungen, Konkurrenzdruck, geringe Mobilitätsbereitschaft, Publikumsschwund – Kulturorganisationen sind mit einem veränderten Kulturverhalten konfrontiert. Wollen Kulturorganisationen zukunftsfit sein, müssen sie die Art und Weise, wie sie tagtäglich arbeiten, grundlegend überdenken.
Dabei unterstützt das internationale Trainingsprogramm „FULCRUM – Make it happen: Community Building and Audience Development for the Future”:
- Ihr erfahrt, wie ihr eine solide Community rund um eure Kulturorganisation strategisch aufbauen könnt.
- Ihr lernt, wie ihr systematisch relevante Daten erhebt und diese in der Praxis für eine Publikumsentwicklung nutzen könnt;
- Ihr werdet von Expert*innen dabei unterstützt, eure Zukunftsbedürfnisse zu identifizieren und notwendige Transformationsprozesse praktisch anzugehen.
- Und ihr könnt euch mit Kulturorganisationen aus Europa vernetzen und austauschen, die ebenfalls ihre Arbeit mit und für ihre Communities & Publika neu denken wollen.
Die Konzeption des Programms baut auf euren Erfahrungen auf und wird auf eure Bedürfnisse und Interessen abgestimmt. Unterstützt werden wir dabei von der Londoner Audience Agency, einer der erfahrensten Organisationen im Bereich der Publikumsentwicklung.
Programmablauf internationales Trainingsprogramm:
- Mai/Juni 2024: Bedarfsanalyse (online)
Erhebung der individuellen Ausgangslage und Interessenschwerpunkte der teilnehmenden Kulturorganisationen, um Inhalte und Design der Trainingsakademie spezifisch auf euren Bedürfnisse abstimmen zu können; - 18.-20. September 2024: Trainingsakademie in Wien
zweieinhalbtägiges Training zur Kompetenzvermittlung und Vernetzung - November 2024 – März 2025: Drei Learning Labs (online)
Feedback und Unterstützung bei den ersten Umsetzungsschritten in der Praxis - April 2025: Programmabschluss und Zertifizierung der Teilnahme
Hinweis: Die Arbeitssprache des Trainingsprogramms ist Englisch. Wir erwarten kein „Oxford-Englisch“, jedoch ist es notwendig, dass ihr hinreichend Diskussionen in Englisch folgen und euch aktiv einbringen könnt!
Zielgruppe:
Das Trainingsprogramm richtet sich gezielt an Mitarbeitende von soziokulturellen Zentren und Initiativen, die Mitglieder des Bundesverband Soziokultur sind.
Besonderes Augenmerk bei der Auswahl liegt auf der Bereitschaft der Kulturorganisation, notwendige Transformationsprozesse umzusetzen und weiterverfolgen zu wollen. Ebenso sollten sich Teilnehmende bereit erklären, das erworbene Wissen und ihre Erfahrungen in ihren Netzwerken und Kontexten als „Botschafter*innen“ weiterzugeben (z. B. bei Workshops, Diskussionen, Presseanfragen etc.).
Kosten:
Die Teilnahme am Programm ist kostenlos. Reise- und Übernachtungskosten für die Teilnahme an der Trainingsakademie in Wien werden gemäß der Bestimmungen unserer Richtlinie für nachhaltiges Reisen erstattet.
Ihr müsst euch jedoch darüber bewusst sein, dass das Training und eure anschließenden Transferaktivitäten Zeit in Anspruch nehmen werden: Bedenkt, dass dies nicht nur die Teilnahme an der Trainingsakademie in Wien und den folgenden Online-Sessions („Learning Labs“) selbst umfasst, sondern auch die Zeit für die Vorbereitung relevanter Informationen, Abstimmungen innerhalb der Organisation sowie die Vorbereitung möglicher erster Umsetzungsschritte.
Bewerbung:
Eine Bewerbung via Online Formular bis 22. April ist möglich: Link zum Bewerbungsformular.
Die Bekanntgabe der ausgewählten Teilnehmenden erfolgt bis 22. Mai 2023.
Hinweis: Da die Arbeitssprache des Trainings Englisch ist, ist auch das Bewerbungsformular nach Möglichkeit in Englisch auszufüllen.
Auswahlkriterien:
- Position in der Kulturorganisation, die es ermöglicht, Transformationsprozesse anzustoßen (unabhängig vom Beschäftigungsstatus).
- Bereitschaft und Kapazität der Kulturorganisation, notwendige Transformationsprozesse umzusetzen und weiter zu verfolgen
- Bereitschaft, erworbenes Wissen und Erfahrungen in ihren jeweiligen regionalen Kontexten als “Botschafter” zu teilen (z. B. in Workshops, Diskussionen, Interviews).
- Vorerfahrungen im Bereich Publikumsentwicklung und Community Building sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend erforderlich.
- Bewerbungen von Kulturorganisationen sowie Mitarbeitenden mit geringeren Möglichkeiten zur Teilnahme an internationalen Trainingsaktivitäten werden bevorzugt behandelt.
Insgesamt werden 24 Kulturorganisationen aus 8 Ländern ausgewählt (3 Teilnehmende pro Land bzw. Netzwerk). Pro Kulturorganisation kann nur ein*e Vertreter*in an der Trainingsakademie in Wien und den nachfolgenden „Learning Labs“ teilnehmen. Die Vorauswahl der Teilnehmenden aus Deutschland erfolgt durch den Bundesverband Soziokultur, die finale Auswahl wird in Abstimmung zwischen allen FULCRUM-Partnern vorgenommen, um eine ausgewogene Zusammensetzung zu gewährleisten.
Gut zu wissen: Für Personen, die gerne teilnehmen möchten, jedoch besondere Bedürfnisse haben bzw. spezifische Barrieren überwinden müssen (z.B. Begleitperson erforderlich), sieht das Programm die Möglichkeit einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung vor, um die Teilnahme zu ermöglichen. Informiert uns darüber bitte über das Bewerbungsformular oder durch direkte Kontaktaufnahme!
Kontakt:
Bei Rückfragen stehen wir euch gerne unterstützend zur Verfügung: Franziska Mohaupt, Referentin für Nachhaltigkeit beim Bundesverband Soziokultur. E-Mail: Franziska.mohaupt@soziokultur.de
Hintergrund:
Das Trainingsprogramm ist Teil des Erasmus+ finanzierten Projekts „FULCRUM“. Ziel des Projekts ist es, soziokulturelle Zentren zukunftsfit und handlungsfähig zu machen (fulcrum = engl. für Dreh- und Angelpunkt bzw. Hebelwirkung – etwas, das Handlungsfähigkeit verleiht). Das Projekt FULCRUM wird getragen von Partner*innen in Belgien, Deutschland, Estland, Italien, Lettland und Österreich sowie dem European Network of Cultural Centres (ENCC).
Welche Auswirkungen haben Kulturveranstaltungen auf die Umwelt? Wie können soziokulturelle Einrichtungen zu mehr Umweltschutz und zur Eindämmung des Klimawandels beitragen? Im Rahmen unseres europäischen Schulungsprogramms gehen wir auf diese Fragen ein und vermitteln euch Instrumente und Finanzierungsmöglichkeiten, um Maßnahmen der Betriebsökologie in euren Einrichtungen umzusetzen. Das Programm möchte euch zu Botschafter*innen der Nachhaltigkeit weiterbilden.
Bewerbungen bis zum 22. April 2024! Die Teilnahme ist kostenlos.
Unser Handeln und insbesondere unser Wirtschaften basiert auf der Ausbeutung und Zerstörung von Ökosystemen. Es stellt uns zunehmend vor Herausforderungen, die unsere Gesellschaft bedrohen. Kultur und insbesondere die Soziokultur können und sollten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung einer sozial tragfähigen Transformation spielen. Kultureinrichtungen können Vorbild sein, indem sie ihren eigenen Ressourcenverbrauch reduzieren und zeigen, dass das Einhalten der ökologischen Leitplanken nicht mit Kulturverzicht gleichzusetzen ist. Hierfür bedarf es an Fach- und Transformationswissen und den Mut, sich einer der drängendsten Fragen für unser aller Überlegen zu stellen.
Zielgruppe
Das Trainingsprogramm richtet sich an Mitarbeiter*innen von Kulturzentren mit soziokulturellem Ansatz. Besonders interessant ist das Programm für soziokulturelle Einrichtungen, die das Thema Betriebsökologie aktuell ernsthaft angehen möchten oder bereits erste Erfahrungen gesammelt haben. Zentrales Kriterium ist eure Bereitschaft, das Gelernte in eurer täglichen Arbeit in die Praxis umzusetzen und eure Erfahrungen mit anderen Kulturschaffenden in euren Netzwerken und Gemeinden zu teilen. Das verstehen wir unter „Botschafter*in für Nachhaltigkeit“ („ambassador“). Es ist sehr wichtig, dass ihr in eurer Organisation eine Position innehabt, die es euch ermöglicht, Veränderungen anzustoßen und das Gelernte in eurer Organisation anzuwenden. Vorkenntnisse im Bereich Umweltmanagement sind von Vorteil.
Kosten
Die Teilnahme an dem Programm ist kostenlos. Die Reise- und Unterbringungskosten für die Teilnahme an der Trainingsakademie in Turin werden gemäß den Bestimmungen unserer Richtlinie für nachhaltiges Reisen (siehe Seitenende) erstattet.
Die von den Teilnehmern für die Schulung aufgewendete Arbeitszeit wird nicht erstattet: Neben der zweieinhalbtägigen Präsenzschulung und den sechs Online-Schulungen rechnen wir mit jeweils 2-3 Tagen für das Eigenstudium und die Bearbeitung von Aufgaben zwischen den einzelnen Trainingseinheiten.
Bewerbung & Auswahlverfahren
Die Bewerbung ist per Online-Formular bis zum 22. April möglich: Link zum Online-Bewerbungsformular
Die Bekanntgabe der ausgewählten Teilnehmer erfolgt bis zum 22. Mai 2023.
Insgesamt werden 24 Kulturorganisationen aus 8 Ländern (3 Teilnehmende pro Land bzw. Netzwerk) ausgewählt. Pro Kulturorganisation kann nur ein*e Vertreter*in an dem Training in Wien und den nachfolgenden Online-Trainings teilnehmen.
WICHTIG: Bei der Auswahl der Teilnehmer*innen wird ein Fokus auf die Bereitschaft der Kulturorganisation gelegt, Transformationsprozesse umzusetzen und zu verfolgen. Die Teilnehmer*innen sollten darüber hinaus bereit sein, das erworbene Wissen und die Erfahrungen in ihren jeweiligen regionalen Kontexten als “Botschafter*innen” weiterzugeben (z.B. in Workshops, Diskussionen, Interviews).
Sprecht bei Rückfragen Franziska Mohaupt vom Bundesverband Soziokultur an: Franziska.mohaupt@soziokultur.de
Hintergrund
Das Trainingsprogramm ist Teil des Erasmus+ finanzierten Projekts „FULCRUM“. Ziel des Projekts ist es, soziokulturelle Zentren zukunftsfit und handlungsfähig zu machen (fulcrum = engl. für Dreh- und Angelpunkt bzw. Hebelwirkung – etwas, das Handlungsfähigkeit verleiht). Das Projekt wird getragen von Partner*innen in Belgien, Deutschland, Estland, Italien, Lettland und Österreich sowie dem European Network of Cultural Centres (ENCC).
In 30 Jahren hat sich das Waschhaus Potsdam von einem besetzten Haus zu Brandenburgs größtem soziokulturellen Zentrum entwickelt. Jährlich zieht es mit seinem facettenreichen Veranstaltungsprogramm von Tanz, über zeitgenössische Kunst, Clubkultur sowie Konzert- und Literaturveranstaltungen über 120.000 Besuchende an. Und Mitwirkende! Denn das Waschhaus Potsdam ist und bleibt ein soziokulturelles Zentrum! Das Team bringt nicht nur etablierte Künstler*innen auf die Bühne, sondern erkundet neue Wege des künstlerischen Ausdrucks und fördert gezielt aufstrebende Talente. Der Künstler Marc Brandenburg etwa stellte 2018 in im Kunstraum des Waschhaus Potsdam aus, ehe er auf der Art Basel entdeckt wurde.
Nach Corona steigende Besucher*innenzahlen
Herausforderungen meistert das Team schon viele, die meisten drehen sich um die Finanzen. Und doch bleibt immer der Optimismus: Nach der Pandemie hat das Waschhaus Potsdam die Besucher*innenzahlen aus der Vor-Corona-Zeit bereits 2022 übertrumpft, wie der Statistische Jahresbericht belegt. Im Jubiläumsjahr 2022, das das Kulturhaus mit Bands wie den Beatsteaks und Großstadtgeflüster feierte, begrüßte das Waschhaus insgesamt 133.140 Gäste. Eine rauschende Zahl und auch ein Ausrufezeichen für die Relevanz der Soziokultur!
Nachhaltig und digital gut aufgestellt
Das Tausendsasserteam des Waschhauses schafft es nicht nur, selbst asuzubilden, sondern auch noch, die nachhaltige Ausrichtung voranzutreiben. 2023 konnte das Waschhausmit Unterstützung des Landes in energiesparende Multifunktions-Scheinwerfer investieren. Diese Innovation ermöglicht es, bei rund 300 Veranstaltungen pro Jahr bis zu 80 Prozent Energie einzusparen.
Und auch beim Thema Digitalisierung ist das Waschhaus aktiv und ermöglichte es z. B. Schüler*innen, den digitalen Raum durch die Erstellung von Kunst durch Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) zu erforschen.
Das Pilotprojekt „Unendlich plurale Welten“ startete Anfang 2022 und ist inzwischen als festes Projekt „Digital Art Rally“ im Waschhaus beheimatet. Es ist in vier Stationen unterteilt und wird von Studierenden der Universität Potsdam unter Leitung von Maja Dierich-Hoche und Katharina Brönnecke betreut. Schüler*innen können VR-Arbeiten erstellen, Anwendungen testen, in einer AR-Umgebung Objekte einscannen und mit diesen digital interagieren sowie Werke in einer digitalen Galerie erkunden.
Eine App, die es jedem ermöglicht, die virtuelle Ausstellung von zu Hause aus zu erleben, wird Anfang 2024 veröffentlicht. Die Entwicklung wird vom Land Brandenburg und dem Fonds Soziokultur gefördert. Die größte Herausforderung bestand für das Team in der Aufklärungsarbeit: Personen, die den Wert von digitaler Kunst nicht sofort erkennen, muss man die Begeisterung dafür noch vermitteln.
Typisch Soziokultur
Einst die ,Königliche Garnisons-Dampfwaschanstalt‘, sind unter dem Dach des Kulturbetriebs Waschhaus heute auch der Kunstraum Potsdam und das Tanzstudio OXYMORON Dance Company beheimatet. Spartenübergreifend finden eine Vielzahl unterschiedlicher Formate statt, neben Konzerten, Lesungen und Freiluft-Kinosommer, ziehen die Tanz- und Comedy-Events seit den 1990er Jahren weit über Brandenburg hinaus Begeisterte an.
Alle sollen an Kunst und Kultur teilhaben können, so das Selbstverständnisses des Hauses, das sich in niederschwelligen kulturellen Angeboten zeigt und in Projekten, in denen alle Altersgruppen eingeladen sind, selbst aktiv mitzugestalten. Der programmatische Mix aus bekannten Gesichtern auf der Bühe, Kindertagen und Flohmärkten, aktuellen Kunstausstellungen und offenen Kulturangeboten macht das Waschhaus zu einem lebendigen Treffpunkt, der Menschen zusammenbringt und mit der Magie der Kunst die Magie der Gemeinschaft erlebbar macht.
Geschäftsführer Mathias Paselk beantwortet die Frage, was Soziokultur für das Waschhaus bedeutet, pragmatisch.
„Kurz gesagt: Wir sind was wir tun. Das soll bedeuten, wir gestalten unser Programm mit Hinblick auf die vier Aspekte: Partizipation, Diskussion, Rezension und Rezeption. Anhand dessen entwickeln wir mit vielen tollen Partnern ein abwechslungsreiches Kulturangebot das einladen und anregen soll. Wir verstehen uns als Ermöglicher von Möglichkeiten und freuen uns immer wieder über kreative Ideen und Konzepte die wir dann umsetzen dürfen.“
Ort für aktuelle kulturpolitische Auseinandersetzung
Kein Wunder also, dass der Auftakt der fünfteiligen Brandenburger Konferenzreihe „MusicBase on Tour” am 12. April 2024 unseres Landesverbandes ImPuls Brandenburg im Waschhaus Potsdam stattfindet. Die Konferenzreihe hebt die dringlichen Fragen hervor, die eine starke Soziokultur von morgen betreffen: Wie sieht eine Kultur für alle aus und wo findet diese statt? Wie stellen wir uns eine zukunftsfähige, innovative und bedarfsorientierte Kulturpolitik von morgen vor? Wie sollten sich die Arbeits-, Rahmen-, und Förderbedingungen gestalten?
Die erste Veranstaltung im Waschhaus lädt dazu ein, die Zukunt der Kulturpolitik in Brandenburg mitzugestalten und unter dem Motto „Let’s shape our future: Echte Perspektiven für eine progressive Kulturpolitik in Brandenburg” zu dikutieren. Brandenburg ist durch die Landtagswahlen unter dem Brennglas, wie sich hier kulturpolitische Entscheidungen formen, weshalb die Ergebnisse der Konferenz auch über Brandenburgs Grenzen hinaus wichtige Impulse setzen wird.
Seit 2023 gibt der CO2-Kulturrechner eine einheitliche Erhebungsmethode für die CO2-Bilanzierung von Kultureinrictungen vor. Nun wurde der Rechner mit neusten Emissionsfaktoren zur Bilanzierung aktualisiert und ab sofort nutzbar. Kultureinrichtungen können damit für das zurückliegende Jahr 2023 ihre Treibhausgasemissionen aktuell berechnen.
Bilanzieren für die Soziokultur
Doch was bringt das Bilanzieren und wie sollte das Tool für die Soziokultur genutzt werden? Sicherlich kann ein Nachhaltigkeitsmanagement auch ohne Bilanzierung gut sein. In vielen Kulturbereichen gehört die Bilanzierung bereits als fester Mindeststandard dazu und Bilanzierung soll zum festen Bestandteil des gesamten Kultubereichs werden. Deshalb wird das Thema auch für die Soziokultur immer bedeutender.
Zunächst stellt die Bilanz eine Zustandsbeschreibung zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Erstellt eine soziokulturelle Einrichtung eine Bilanz in regelmäßigen Abständen, lässt sich eine Entwicklung beobachten. Der Nutzen ergibt sich aus dem, was mit den Informationen gemacht wird, die eine Bilanz liefert.
Wie eine Nutzung des CO2-Kulturrechners sinnvoll ist, haben wir für die Soziokultur deshalb hier zusammengefasst.
Zudem hat der Bundesverband Soziokultur Ende 2023 ein Projekt begonnen, das gemeinsam mit soziokulturellen Zentren ökologische Mindeststandards für die Soziokultur entwickelt. Mit dem Projekt möchte der Bundesverband den Rahmen für das Mindestmaß an Betriebsökologie für die Soziokultur selbst setzen und praxisnah ausrichten.
Der CO2-Rechner für Kultureinrichtungen wurde unter der Federführung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg entwickelt.
Wie sieht eure soziokulturelle Arbeit in der Zukunft aus? Wie sollte sie aussehen? Was ist die gemeinsame Vision für eine zukunftsfähige Kulturarbeit in ganz Europa und wie kommen wir dorthin? Nehmt teil an einem europaweiten Austauschprozess zwischen Kulturinitiativen, bei dem wir aufbauend auf euren Erfahrungen und Erwartungen gemeinsam an „Visions for the Future“ arbeiten. Kick-Off ist am 5. März 2024, Anmeldung bis 26.2. erforderlich.
Inspirierende Ideen für eine sozial und ökologisch nachhaltigere Zukunft teilen
Die Gesellschaft und damit auch die Kulturarbeit in Europa stehen vor großen Herausforderungen. Zunehmende soziale, ökonomische und regionale Ungleichheiten, Demokratiemüdigkeit, Klimawandel in Echtzeit und die Folgen der aktuellen Krisen setzen Kulturinitiativen und ihre Mitwirkenden unter Druck. Gleichzeitig arbeiten viele Kulturarbeiter*innnen mit inspirierenden und innovativen Ideen und Ansätzen an einer sozial und ökologisch nachhaltigeren Zukunft. Es ist notwendiger denn je, kreative und demokratie-bejahende Kräfte zu bündeln und von Erfahrungen anderer zu lernen.
Gemeinsam europäisch Visionen für die soziokulturelle Arbeit entwickeln
„Visions for the Future“ bietet Raum, mit Kolleg*innen aus ganz Europa mögliche Zukunftsvisionen für die soziokulturelle Arbeit zu diskutieren: Was können wir aus der Gegenwart lernen? Wie könnte eine nachhaltigere Zukunft aussehen? Und was ist die Basis für die Entwicklung von Maßnahmen, die die Soziokultur zukunftsfähig macht?
Ziel ist es, den Grundstein für eine zukunftsfähige Kulturarbeit zu legen, die sowohl eure Kulturinitiative individuell unterstützt als auch die Soziokultur insgesamt stärken soll. Dafür sollen die Erkenntnisse und Ergebnisse des Prozesses in die öffentliche und politische Diskussion einfließen.
Was wann wie konkret?
Es finden drei Online Brainstorming-Sessions statt, stets zu einem thematischen Fokus. Um von abstrakten Überlegungen zu konkreten Ideen zu kommen, werden in den Sessions Design Thinking Techniken eingesetzt. Die Sessions werden von Anna Maria Maria Ranczakowska (wissenschaftliche Mitarbeiterin des European Network of Cultural Centres, ENCC) moderiert und von den FULCRUM Projektpartnern begleitet.
Erstes FULCRUM Online-Brainstorming „Mapping our Future“
Online Brainstorming-Session: Mapping our Future am 5. März von 10 – 13 Uhr
Was passiert gerade in der Welt? Wie beeinflussen diese Ereignisse uns und unsere Kulturorganisationen? Wie können wir die Zukunft aktiv mitgestalten? Inwiefern teilen wir Erfahrungen über regional-spezifische Kontexte hinweg in Europa und inwiefern unterscheiden sie sich?
Anmeldung erforderlich bis 26.2. unter: www.cult.be/form/visions-for-the-future-brainstor
Zielgruppe: Soziokulturelle Akteure
Das Brainstorming richtet sich an alle, die sich in soziokulturellen Initiativen engagieren – gleich ob beruflich oder ehrenamtlich, ob in einem großen Mehrspartenhaus oder einem temporären Kollektiv. Entscheidend ist eure Bereitschaft, Einblick in eure Erfahrungen und Erwartungshaltungen zu geben und der Formulierung einer Vision mitdiskutieren zu wollen.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Vorbereitung ist nicht erforderlich. Lediglich eurer Investment an Zeit ist gefragt!
WICHTIG: Die Arbeitssprache ist Englisch.
„Visions for the Future“ ist Teil von FULCRUM, einem dreijährigen Erasmus+-Projekt im soziokulturellen Sektor und wurde von den Akteuren des European Network of Cultural Centres (ENCC) gemeinsam entwickelt.
Mehr zu FULCRUM.