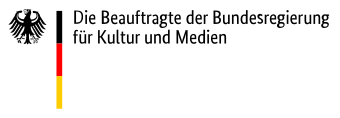Für Kulturinstitutionen bedeutet Digitalisierung Chance und Herausforderung zugleich. Es mag so scheinen, als wären große kommerzielle oder staatliche Institutionen mit ihren vielfältigen Ressourcen eher in der Lage, den digital-analogen Optionsraum zu füllen, als kleinere soziokulturelle Zentren, die ehrenamtlich geführt werden. Diese Wahrnehmung ist aber oft falsch. Auch kleine Einrichtungen können auf vielfältige Art und Weise im digitalen Raum aktiv sein. Ich möchte dies am Beispiel des soziokulturellen Zentrums Haus am Westbahnhof in Landau in der Pfalz beschreiben. Dieses Kulturzentrum wird durch einen gemeinnützigen Verein getragen. Seine Gründung und der Bau des Hauses in den 1980er Jahren und ebenso der Betrieb waren und sind bis heute das Ergebnis der Arbeit eines ehrenamtlichen Teams.
Jetzt sind u. a. das Bezahlsystem, Anfragen zur Raumbuchung, Kalender und viele Kommunikationsaktivitäten digitalisiert
Für bestimmte Aufgaben wie die Verwaltung und die Buchhaltung sind im Laufe der Jahre hauptamtliche Stellen im geringen Rahmen geschaffen worden. Das Team des Hauses hatte mich angefragt, um mit mir als Berater neue digital-analoge Formate zu entwickeln. In unserem ersten Workshop analysierten wir den Ist-Zustand der Digitalisierung auf allen Ebenen und stellten fest, dass wir zuerst nachhaltige digital-analoge Rahmenbedingungen schaffen mussten, um dann ein digital-analoges Kulturzentrum entwickeln zu können. Nach dem Motto „Keep the train rollin‘“ haben wir das Tagesgeschäft des Kulturzentrums sowie die Strukturen und Prozesse der Geschäftsstelle und des Vereins analysiert und umfassend weiterentwickelt. Ausgangspunkt war das TFK-Modell, das digitale Prozesse in die drei Handlungsfelder Technologie (Hard- und Software), Funktion (Formate und Prozesse) und Kultur (Mindsets und Strukturen) unterteilt. Damit konnten das Bezahlsystem, der Umgang mit Künstler*innenanfragen und Anfragen zur Raumbuchung, der Kalender und viele Kommunikationsaktivitäten digitalisiert werden.
Mehr Zeit für eigentliche Kulturarbeit durch Digitalisierung von Prozessen
Das Hauptziel war eine Vereinfachung der Strukturen und Abläufe, um durch digitale Lösungen mehr Zeit für die eigentliche Kulturarbeit zu schaffen. Parallel dazu entwickelten wir ein Konzept für die inhaltliche Weiterentwicklung des Hauses hin zu einem digital-analogen Kulturort, das in den nächsten Jahren umgesetzt wird.
Eine Vereinfachung der Strukturen durch digitale Lösungen soll mehr Zeit für die eigentliche Kulturarbeit schaffen.
Der Startschuss dieses Transformationsprojektes fiel am 15. Dezember 2022, der Beratungsprozess dauerte mehrere Monate und bestand aus einer Kombination aus Workshops vor Ort und Online-Meetings. Alles musste parallel zum laufenden Betrieb des Kulturzentrums mit vielen Ehrenamtlichen stattfinden. Wichtig war, seine Geschichte und seine Mindsets zu integrieren, also nicht alles Alte abzuschaffen, keinen Konkurrenzkampf zwischen digitalen und analogen Kulturmodellen zu befeuern, sondern die – logische – Weiterentwicklung des Haus am Westbahnhof zu unterstützen.
Der Entwicklungsprozess ist fast ein Jahr später noch nicht abgeschlossen. In den vergangenen Monaten hat das Team ein Fundament geschaffen, auf dem nun weitere Entwicklungsschritte möglich sind.
Im Transformationsblog und dazugehörendem Podcast beschreiben die Teammitglieder, wie sie den Prozess erlebt haben und was er für das Kulturzentrum bedeutet: https://hausamwestbahnhof.de/%20ueber-uns/keep-the-train-rollin/
Dieser Beitrag ist erschienen in der SOZIOkultur 4/2023 Digitalität
Pressemitteilung, 16. April 2024
Angesichts der aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen startet der Bundesverband Soziokultur gemeinsam mit seinen Landesverbänden die Kampagne „Wir leben Demokratie!“ zur Stärkung der Demokratie und Vielfalt in Deutschland. Gerade jetzt ist es wichtig, die zentrale Rolle soziokultureller Zentren und Initiativen in der Aufrechterhaltung demokratischer Prozesse herauszustellen. Denn sie sind wichtige Freiräume für den Dialog und für zivilgesellschaftliches Engagement.
Soziokultur lebt in allen Bereichen demokratische Werte, sei es in der niedrigschwelligen Vermittlungs-, Bildungs- und Kulturarbeit, die Interessierte zum Mitgestalten einlädt, sei es als Orte gelebter Demokratie in den Arbeitsstrukturen.
„Soziokultur schafft Räume für vielfältigen, gleichberechtigten Austausch und gesellschaftliche Integration. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen motiviert werden, auch außerhalb dieser Räume ihre Stimme einzubringen“, erklärt Kristina Rahe, Referentin für Demokratiestärkung des Bundesverband Soziokultur. „Denn es geht schließlich darum sicherzustellen, dass möglichst viele erkennen, wie wertvoll es ist, sich in demokratische Prozesse einzumischen.“
Die Kampagne „Wir leben Demokratie!“ unterstreicht die tiefgreifende Wirkung soziokultureller Praktiken bei der Förderung von Vielfalt, Gleichheit und aktivem gesellschaftspolitischem Engagement. Sie zielt darauf ab, die Stimmen und Aktivitäten derjenigen zu verstärken, die sich in ihrer alltäglichen Arbeit für demokratische Grundsätze einsetzen, so wie es die Akteur*innen in soziokulturellen Zentren und Initiativen tun.
In seinem Positionspapier zur Demokratiestärkung stellt der Bundesverband die Wichtigkeit der Soziokultur heraus und fordert die Politik zur angemessenen Unterstützung auf.
Der Bundesverband ruft Einzelpersonen und Organisationen im ganzen Land dazu auf, sich der Kampagne „Wir leben Demokratie!“ anzuschließen, indem sie ihr Engagement für die Demokratie sichtbar machen.
„Zeigen wir, dass und wie die Demokratie durch unsere gemeinsamen Anstrengungen weiterhin gedeiht“, wünscht sich Kristina Rahe. „Gemeinsam setzen wir ein Ausrufezeichen gegen Rassismus und Populismus und treten für eine Gesellschaft ein, die Diversität und Gleichberechtigung begrüßt.“
___________________________
Kontakt: Barbara Bichler | Barbara.Bichler@soziokultur.de | 0176 45 75 66 88
Der Bundesverband Soziokultur ruft angesichts der gesellschaftspolitischen Entwicklungen dazu auf, gemeinsam und sichtbar ein Ausrufezeichen für Demokratie und Vielfalt zu setzen. Wir positionieren uns klar und deutlich: Wir treten für die Demokratie ein, in all unserem Schaffen!
Für eine offene, pluralistische Gesellschaft braucht es offene Orte der Gemeinschaft
Schnell, unkompliziert und mit weit geöffneten Türen schafft es die Soziokultur über Kunst und Kultur, Menschen aller Altersgruppen in Verbindung und in den Dialog zu bringen – unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen oder politischen Hintergrund.
Soziokulturelle Zentren und Initiativen stehen schon jetzt nicht nur in Sachsen, Brandenburg und Thüringen im Fokus rechtsextremer Anfeindungen. Wir sagen deutlich: Diese Orte müssen als Freiräume erhalten bleiben, als belebende Orte der Gemeinschaft, Experimentierfelder für Engagement und gesellschaftspolitische Auseinandersetzung. Gerade jetzt braucht es diese Räume für Begegnung, an denen es möglich ist, gemeinsam soziale Anliegen zu diskutieren und Lösungen für ein gutes Zusammenleben zu finden. All das ist genuin für eine offene und pluralistische Gesellschaft.
Vielfalt bedeutet Kraft und gleichberechtigte Teilhabe
Ob mit kollektiven Führungsmodellen, Strukturen auf Ehrenamtsbasis, der gleichwertigen Anerkennung unterschiedlicher Kulturformen oder der Beteiligung aller – die Soziokultur lebt Demokratie in all ihren Arbeitsfeldern. Kulturelle Vielfalt und Selbstbestimmung, das Experimentieren und Neuentwickeln stehen im Vordergrund und bereichern gegenseitiges Verständnis. In den soziokulturellen Zentren wird eine Gestaltung der Gesellschaft alltäglich erprobt und gelebt – ein idealer Startpunkt für alltägliches politisches Engagement.
Soziokultur schafft gesellschaftliche Integration und Diversitätsorientierung – oftmals ohne dies explizit zu benennen, denn das Grundsatzmotto „Kultur von allen für alle“ kennt keine Exklusion: Alle sind gleichwertig als Beteiligte einbezogen, sind als Nutzer*innen der Kulturorte eingeladen, als Macher*innen statt ausschließlich als Publikum in Erscheinung zu treten. Statt eine Gesellschaft der Singularitäten zu befördern, lebt die Soziokultur Pluralität und ist damit Role Model einer toleranten Gemeinschaft.
Demokratie braucht eigenes Erleben und Selbstwirksamkeit
Durch Beteiligungsformate, die Veränderungen im Umfeld der Mitwirkenden fassbar machen, erleben sich Menschen im Rahmen soziokultureller Aktivitäten als gestaltende Kraft ihrer Alltagsräume. Diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit überträgt sich auch auf weitere demokratische Prozesse. Die Gestaltungskraft und Freude am gemeinsamen Handeln verdeutlichen, wie Engagement direkt und sichtbar wirkt – und wie viel Freude darin steckt.
Soziokulturelle Demokratiearbeit braucht verlässliche Rahmenbedingungen
Die Stärkung der Demokratie durch zivilgesellschaftlich organisierte Kulturarbeit wird umfänglich durch diverse soziokulturelle Zentren und Initiativen und ihre engagierten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden umgesetzt. Wenn sie niedrigschwellig bleiben und in die Breite wirken will, reicht eine eigen erwirtschaftete Finanzierung allein durch Eintritte, Vermietungen oder Kursgebühren jedoch nicht. Über eine verbal oft betonte symbolische Wertschätzung hinaus ist eine dauerhafte, verlässliche und nachhaltige Förderung der soziokulturellen Strukturen unabdingbar. Fragen zur Demokratiestärkung sind immer auch Fragen zu einer nachhaltigen Finanzierung der soziokulturellen Zentren und Initiativen. Wir fordern soziokulturelle Zentren als selbstverständlichen Bestandteil der kulturellen Infrastruktur von Gemeinden in Stadt und Land.
Ein gemeinsames Ausrufezeichen: Kampagne zur Demokratiestärkung
Der Bundesverband und seine Landesverbände starten eine gemeinsame Kampagne, die herausstellt, wie kraftvoll die Demokratiearbeit in den soziokulturellen Zentren und Initiativen umgesetzt wird. Alle Akteur*innen der Soziokultur und darüber hinaus sind eingeladen zu zeigen, wie sie in ihrem Alltag, in ihrer Arbeit, in ihrem Engagement tagtäglich Demokratie leben.
Für alle diejenigen, die ein Ausrufezeichen setzen und sichtbar machen wollen, wie sie sich für Demokratie einsetzen, stellt der Bundesverband in Kooperation mit seinen Landesverbänden Materialien zur freien Nutzung zur Verfügung. Mit dieser gemeinsamen Kampagne möchten wir zeigen: Wir alle leben und lieben die Demokratie, wir glauben an sie als die freiheitliche Gesellschaftsform und setzen uns für sie ein. Rassismus und Verfassungsfeindlichkeit haben keinen Platz!
Man muss sich Nürnberg als gediegene Stadt vorstellen, in die 1973/74 jäh der Ungeist der neuen Zeit hineinfuhr: Als im alten Künstlerhaus in zentraler Lage am Bahnhof ein „Kommunikationszentrum“ einzog, das bald alle nur noch KOMM nannten, fürchteten nicht wenige Einwohner mit freundlicher Unterstützung der lokalen CSU um die bürgerliche Kultur Mittelfrankens. Mit dieser hatte das KOMM denkbar wenig im Sinn. Im Gegenteil: Kultur, wie dieses Zentrum sie betrieb, war all das, was die etablierten Kulturorte nicht haben wollten: Gegen-, Jugend- und Subkulturen, und überhaupt alle möglichen Formen und Veranstaltungen, die mit der Kultur der städtischen Museen, Konzerthäuser und Theater nichts bis gar nichts gemein hatten.
„LSD – Lieder, Songs und Diskussionen“ im KOMM
Hier gab es Tanz und Theater jenseits der Konvention, Handwerk, schrille Musik, die in den Ohren schmerzte, politische Veranstaltungen mit Titeln wie „LSD – Lieder, Songs und Diskussionen“, alternative Film- und Fotoprojekte, Senioren- und Migrantentreffs. Hier trafen sich haufenweise junge Menschen, die sich, statt auf gepolsterten Konzertsesseln zu sitzen und zuzuhören, lieber auf Treppenstufen herumfläzten und die Nacht durchdiskutierten. Und dann die langen Haare, ordinären Klamotten und der süßliche Duft selbstgedrehter Tüten… Dass das Ganze nicht obrigkeitlich gelenkt, sondern selbstverwaltet war, machte es nicht besser.
Offen für alle und alles und obendrein direkt am Bahnhof
Das KOMM war offiziell eine „städtische Dienststelle besonderer Art“. Konkret hieß das: Die Stadt verlangte keine Miete, zahlte Zuschüsse und trug die Verantwortung, ließ gleichzeitig aber die jungen Leute um den Kunstpädagogen Michael Popp weitgehend machen. Da man offen für alle und alles und obendrein direkt am Bahnhof war, sammelten sich um das KOMM nicht nur Künstler, sondern viele gesellschaftliche Randgruppen wie Anarchisten, Junkies oder Obdachlose, weshalb es immer mal wieder krachte und zuweilen die Polizei zugriff. Der Ruf war bald ruiniert bzw. etabliert, „weil die da drin hashen und so“, wie ein Nürnberger Mädchen zu berichten wusste. Kurzum: Die Kultur, die sich hier zeigte, passte weder ästhetisch noch sozial zu dem, was ein Großteil des Bürgertums vor 50 Jahren zu akzeptieren bereit war. Kultur als das „Wahre, Schöne und Gute“ jedenfalls stellte es sich deutlich anders vor.
Der Untertitel des kulturpolitischen Manifests „Die Wiedergewinnung des Ästhetischen“ enthielt das Schlagwort, das von da an einer alternativen Kulturpolitik ihren Markennamen geben sollte: „Perspektiven und Modelle einer neuen Soziokultur“.
Dass das KOMM ausgerechnet im erzkonservativen Bayern des CSU-Landesverwesers Alfons Goppel entstehen konnte, lag vor allem an Nürnbergs Kulturreferenten Hermann Glaser, 46 Jahre alt, SPD. Glaser war einer der großen Kulturvisionäre der Bundesrepublik und Ideengeber hinter dem KOMM. Pünktlich zu dessen Eröffnung brachte er 1974 zusammen mit dem Medienwissenschaftler Karl Heinz Stahl das kulturpolitische Manifest „Die Wiedergewinnung des Ästhetischen“ auf den Markt. Der Untertitel enthielt das Schlagwort, das von da an einer alternativen Kulturpolitik ihren Markennamen geben sollte: „Perspektiven und Modelle einer neuen Soziokultur“.
Soziokultur im Kontext der Neuen Sozialen Bewegungen
Soziokultur: Das war einerseits eine kulturelle Praxis, eine bestimmte Art, Kunst und Kultur zu machen: freies Theater im öffentlichen Raum, selbstverwaltete Clubs und Programm-Kinos, Kunstaktionen in alten Fabrikhallen, Frauenarchive oder Kulturarbeit mit Jugendlichen und Migranten. Solche alternativen Ästhetiken und Kulturprojekte jenseits des Bürgerlichen gab es schon länger: in der Bohème und den Avantgarden, in den Sezessionen und der reformpädagogisch inspirierten Kunstpädagogik um 1900 und in der DDR. Aber erst im Kontext der Neuen Sozialen Bewegungen um und nach 1968 trafen sie in Westdeutschland auf eine Gesellschaft, die sich langsam dafür zu öffnen begann und auf Politiker, die dafür Geld bereitstellten.
So wertete die Soziokultur Kulturformen auf, die bis dato einem bildungsbürgerlich geprägten Publikum als minderwertig galten und erschütterte den Kanon der Hochkultur.
Jetzt entwickelte sich Soziokultur zu einem (linken) politischen Programm, das die Theorie zur Praxis lieferte und bestrebt war, die in Jahrhunderten mühsam dem Alltag enthobene deutsche Kultur wieder zurück auf die Erde zu bringen. Soziokultur wollte das, was als Kultur galt und wofür Kultur zuständig sein sollte, grundlegend neu definieren: Diese Kultur war nicht mehr rein aufs Ästhetische reduziert, exklusiv auf ästhetisch gebildete Kulturbürger und hauptberufliche Künstler zugeschnitten, und sie strebte auch nicht nach Distinktion, um sich von anderen Schichten abzugrenzen. Statt dessen war sie denkbar breit angelegt, akzeptierte Laien-, Breiten- und Populärkultur, die das Kulturestablishment mit hoch gezogenen Augenbrauen wacker ignorierte. So wertete sie Kulturformen auf, die bis dato einem bildungsbürgerlich geprägten Publikum als minderwertig galten und erschütterte den Kanon der Hochkultur.
Rubrum „Kultur für alle“
Freilich war sie ähnlich beseelt von der Idee einer Erziehung des Menschen durch Ästhetik wie das Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts, denn Soziokultur wollte Gesellschaftspolitik betreiben: „Im Mittelpunkt soziokultureller Bildungsarbeit“, postulierten Glaser und Stahl, „hat die Erziehung zur Politik zu stehen, zur Fähigkeit, Umwelt reflektierend wahrnehmen und agierend gestalten zu können.“ Nur so könne der Mensch sich in die Gesellschaft einbringen, nur so sei er befähigt zu politischer Teilhabe: „Der Wiederherstellung der Politik muß die Wiederherstellung des Ästhetischen zur Seite treten, damit die weitgehend vernachlässigten oder zerstörten Voraussetzungen für menschliches Zusammenleben rekreiert werden. Kultur soll die Augen öffnen, die Welt so zu erleben, wie sie ist, und zugleich die Welt gestalten helfen, wie sie sein sollte.“ Damit war der gleichermaßen an Schiller wie an Kritischer Theorie geschulte Ton gesetzt für das Programm einer „Neuen Kulturpolitik“, das der Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann unter dem Rubrum „Kultur für alle“ weiter ausbuchstabieren sollte.
Die Soziokultur verschob die Wertkriterien von der bürgerlichen Ästhetik zur sozialen Wirkung in der Gesellschaft.
Soziokultur war nahbar und in der Mitte des Lebens mit all seinen Problemen angesiedelt. Ästhetik galt ihr als Mittel zum politischen Zweck, nicht als Selbstzweck. Dem Anspruch nach „demokratisch“, sollte Soziokultur alle Menschen (und nicht nur eine kleine Elite von Kennern und Könnern) beteiligen und sie zu selbständiger kreativer Arbeit anleiten. So wollte sie die Bürger sensibler und empfindsamer machen, auf dass sie sich in die Politik einmischten, weil sie sich ihrer Bedürfnisse bewusst waren und diese künstlerisch und verbal artikulieren konnten. Von der Idee einer vermeintlich unpolitischen Kunst in Namen eines alltagsfernen „interesselosen Wohlgefallens“ (Kant) war das denkbar weit entfernt. So verschob Soziokultur die Wertkriterien von der bürgerlichen Ästhetik zur sozialen Wirkung in der Gesellschaft.
Sie verstand und versteht sich bis heute als engagiert, inhaltlich vielfältig, basisdemokratisch organisiert, gemeinnützig, partizipativ und pocht auf permanente „Transformation“, um agil zu bleiben.
Das entsprach so ziemlich genau dem Gegenteil von „affirmativer Kultur“. Mit diesem Begriff hatte der marxistische Philosoph Herbert Marcuse seinerzeit die dominante bildungsbürgerliche Kultur belegt. Ihr warf er vor, den Menschen von seinem vermeintlichen Elend – seiner „Entfremdung“ im arbeitsteilig organisierten Kapitalismus – abzulenken und zu versuchen, die Bevölkerung mit dem herrschenden System zu versöhnen (daher affirmativ), statt sie zu befähigen, ihre prekäre Lage zu erkennen und dagegen aufzubegehren. Soziokultur wollte genau das: Bewusstsein schaffen, die Menschen aufrütteln und wach machen, sie gegen politische Apathie und Desinteresse wappnen. Soziokultur, das war „Phantasie statt Lethargie“, wie es in großen Lettern auf einer Wand im KOMM stand. Sie verstand und versteht sich bis heute als engagiert, inhaltlich vielfältig, basisdemokratisch organisiert, gemeinnützig, partizipativ und pocht auf permanente „Transformation“, um agil zu bleiben.
Kulturarbeit ist (auch) Gesellschaftspolitik
Damit war und ist sie überaus erfolgreich. Werte wie Teilhabe, kulturelle Bildung, die Öffnung zur Alltagskultur oder Diversität, für die Soziokultur früh einstand, sind längst als politische Imperative ins Pflichtenheft der etablierten Museen, Theater und Konzerthäuser eingegangen. Was vor 50 Jahren unerhört war, wird heute mit großer Selbstverständlichkeit bejaht (wenngleich nur bedingt umgesetzt): Kulturarbeit ist (auch) Gesellschaftspolitik. Dieses Umdenken ist freilich nicht allein Verdienst der Soziokultur, sondern folgte einer Verschiebung, die sich international seit den 1970er Jahren vollzieht, in diversen UNESCO-Erklärungen abbildet und in Großbritannien im Mantra der Social Inclusion wohl am tiefsten ins Kultursystem eingeschrieben hat. Eine solche „Transformation“ treibt heute eine neoliberale Politik weiter voran, die Kultur an ihrer „gesellschaftlichen Relevanz“ misst. Sie hat sich auch vormals rand- und widerständige Kulturformate einverleibt.
Die symbolische Anerkennung für die Soziokultur ist also da, die materielle in der Regel nicht.
Soziokultur ist inzwischen weniger ein eigenständiges Reformprogramm jenseits des Staates, sondern etliche ihrer Theatergruppen, Kinos und Zentren, die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit oder die Geschichtswerkstätten haben sich in den etablierten Kulturbetrieb hineingearbeitet. Sie sind Teil der kommunalen und staatlichen Kulturförderung geworden. Die symbolische Anerkennung ist also da, die materielle in der Regel nicht. Das Gefälle zur etablierten Hochkultur ist unübersehbar: Im Vergleich zu dieser bewegen sich die Zuwendungen für Soziokultur aus Steuergeldern im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Nur jede zehnte Stelle hier ist unbefristet und sozialversicherungspflichtig. Viele arbeiten ehrenamtlich, prekär oder in Teilzeit. Die Hälfte des Umsatzes muss Soziokultur im Schnitt selbst erwirtschaften, in der Regel aus befristeten Projektmitteln. Langfristig abgesicherte Arbeit ist so kaum möglich. Deshalb verbuchte es die Szene als großen Erfolg, dass Hessen seine jährliche Förderung für Soziokulturzentren seit 2016 auf mittlerweile fast 2 Mio. Euro vervierfacht und auf langfristige Strukturförderung umgestellt hat.
Kultur ist mit ihr definitiv schichtübergreifender, unkonventioneller und bunter geworden.
Der Argwohn der etablierten Kulturinstitutionen ist der Soziokultur damit sicher, schließlich konkurriert man um dieselben Gelder. Übel genommen wird ihr auch, dass sie den vormals so schön klaren Kanon an förderungswürdiger (Hoch-)Kultur ausgedehnt und die ästhetisch begründeten Qualitätsmaßstäbe des Bildungsbürgertums aufgeweicht hat. Kultur ist mit ihr definitiv schichtübergreifender, unkonventioneller und bunter geworden. Damit trug sie aber auch ihren Teil bei zu postmoderner Beliebigkeit, die neben Nutzen auch Orientierungsverlust stiftete.
Und in Zukunft?
Nach 50 Jahren stehen viele soziokulturellen Projekte nun vor einem Umbruch. Die Generation der Gründer und frühen Mitstreiter tritt ab, Nachfolger sind nicht immer in Sicht. Wo die öffentliche Hand nicht übernimmt, werden sich die Reihen lichten – selbst wenn die Lücken groß sein könnten. In Nürnberg wurde das KOMM bereits 1996 geschlossen, nachdem die CSU die Stadtregierung übernommen und sich mit dem Zentrum auf keine Zusammenarbeit einigen konnte. Das ehemalige Künstlerhaus firmiert heute zusammen mit anderen kommunalen Einrichtungen unter dem Namen KunstKulturQuartier. Es ist weiter ein lebendiger Ort der freien Szene. Selbstverwaltung und Subkulturen allerdings hat es hier hinweggerafft.
———————————
Thomas Thiemeyer ist Professor für Empirische Kulturwissenschaft am Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen
Dieser Beitrag wurde erstveröffentlicht am Samstag, den 23. März 2024 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Nr. 71
Mitten in der Transformation
2021 plante die Deutschschweizer Soziokulturszene das Berufssymposium „Labor Soziokultur 3.0“, partizipativ, versteht sich. Das Thema, das dabei besonders rasch zum Fliegen kam, war „Soziokultur und Digitalität“. Wenige Monate, nachdem sich die am Thema Interessierten kennengelernt hatten, war ein Verein gegründet: Der Verein Radarstation – Raum zur (Ver-)Ortung von Digitalität in der Soziokultur. Gemeinsam mit anderen Playern veranstaltete die Radarstation schon im Herbst 2022 das „Barcamp Soziokultur und digitaler Wandel“, kurz #SKAmp. Denn wir alle steckten damals bereits mittendrin in der digitalen Transformation. Ziel war es, mit dem Barcamp #SKAmp das Thema „Digitalität in der soziokulturellen Animation (SKA)“ auf den Tisch zu bringen. Wir wollten gemeinsam diskutieren, Ideen entwickeln, Tools kennenlernen, ausprobieren, experimentieren und vieles mehr. Ein reger Austausch über die Auswirkungen, Herausforderungen, Chancen und Potentiale der Digitalisierung innerhalb der soziokulturellen Animation war geplant.
#SKAmp22
Ein Barcamp wird auch „Unkonferenz“ genannt. Dabei wird bewusst kein Konferenzprogramm im Voraus festgelegt. Die Themen, die in den Sessions besprochen oder bearbeitet werden sollen, werden von den Anwesenden zu Beginn der Veranstaltung gemeinsam festgelegt. Man spricht daher auch lieber von Teilgebenden als von Teilnehmenden, um diese aktive Rolle zu unterstreichen. Denn ohne die Anwesenden gibt es bei einem Barcamp keine Inhalte.
Die Themen der Sessions machten die umfassende Bedeutung des digitalen Wandels für die Soziokultur deutlich: Egal ob als Jugendarbeiter*in, Betriebsleitung, Quartierarbeiter*in oder Altersbeauftragte*r – in allen Funktionen und Rollen stehen wir vor neuen Fragen und veränderten Aufgaben. So ging es beim #SKAmp22 um Wissensmanagement sowie um Digitalstrategien von Organisationen ebenso wie um die Gestaltung digitaler Angebote mit Blick auf die Ziele der soziokulturellen Animation oder die (Digital-)Kompetenzen von Adressat*innen.
#SKAmp23
Was sich bewährt, sollte weitergeführt werden – und so gab es auch in diesem September ein eintägiges Barcamp, das #SKAmp23. Hinter der Veranstaltung stehen ein noch breiter abgestütztes Kernteam und 50 anwesende Fachpersonen. Auch diesmal haben alle Beteiligten ein vielfältiges Programm ermöglicht. Die Inhalte sind gut im Programm (s. Sessionplan) dokumentiert. Einige Erkenntnisse und Diskussionen sind hier zusammengefasst:
- Digitale Bildung findet auch innerhalb informeller Bildung statt, somit hat die soziokulturelle Animation (auch) den Auftrag, digitale Skills weiterzugeben. Dafür brauchen wir Grundkompetenzen und die eigene Neugier. Denken wir dies weiter, so wird klar, dass sich unsere Arbeit nochmals stark verändern wird, wenn wir Sozialräume offiziell als hybrid betrachten und damit Onlinegames und Social Media als Teil davon anerkennen. Für Jugendliche – und auch für Erwachsene – sind sie es längst.
- Nur, das alles geht nicht einfach so nebenbei. Um der Digitalität gerecht zu werden, braucht es Know-how, Konzepte, entsprechende Infrastruktur, Zeit und die strukturelle Verankerung im Betrieb. Da besteht weitgehend noch Handlungsbedarf hinsichtlich zusätzlicher (!) Ressourcen. Die Auftraggebenden und Arbeitgebenden sind gefragt.
Merke: Schon für einen guten Social-Media-Auftritt sind mindestens zwei Stunden pro Woche aufzu- wenden. Auch müssen künftig gewisse Lösungen national gedacht werden, nicht regional wie bisher. So ist der digitale Raum quasi grenzenlos und der Zugang, der Log-in, nicht an den Wohnort gebunden. - Die zahlreichen Tools und Apps machen zudem die tägliche Arbeit in der soziokulturellen Animation komplexer. Welches Tool ist wofür geeignet, wo sind zusätzlich auch Datenschutz und Usability gewährleistet? Zahlreiche Fachpersonen suchen nach Orientierung und so wurde vor Ort eine Sammlung1 von bewährten Links zusammentragen.
- Gleichzeitig wurde beim SKAmp23 das Thema Nähe und Distanz im digitalen Raum vertieft, im Kontext von Daten- und Persönlichkeitsschutz. Die Adressat*innenschaft soll geschützt sein, gleichzeitig müssen die Fachpersonen für sich selbst definieren können, wie stark sie sich im beruflichen Kontext digital darstellen und ihre eigenen Grenzen setzen.
Unsere Arbeit wird sich stark verändern, wenn wir Sozialräume als hybrid betrachten.
Blick in die Zukunft
Zuletzt richteten die Teilgebenden beim SKAmp23 den Blick in die Zukunft. Organisationen der soziokulturellen Animation müssen sich – wie alle Organisationen – durch Strukturen von ihrer Umwelt abgrenzen, um Zugehörigkeit und Arbeitsprozesse zu ermöglichen. So entstehen Grenzen. Digitale Tools kratzen an solchen Grenzen und weisen auf eine Utopie einer poststrukturellen soziokulturellen Animation hin. Was braucht es, damit aus der Utopie eine konkrete Utopie wird? Darüber wurde genauso diskutiert wie über ein Nutzer*innenbasiertes Interface, das diese dabei unterstützen soll, die richtige Fachstelle zu finden. Apropos Zukunft: Die Voten im Abschlussplenum machten nochmals deutlich, dass im Format Barcamp die Vernetzung untereinander so richtig gelungen ist. Es gilt nun, weiter die Kräfte zu bündeln und gemeinsam Konzepte zu entwickeln. Damit und mit Blick auf die diversen Inhalte ist klar, dass das #SKAmp24 stattfinden wird.
#SKAmp23 wurde vom Verein Radarstation, dem DOJ – Dachverband für offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz, von Soziokultur Schweiz, der Hochschule Luzern, Institut für Soziokulturelle Entwicklung sowie von Netzwerke GWA Schweiz gemeinsam organisiert. Nicht zuletzt fließen viele Stunden freiwilliger Arbeit ein, dank des Engagements von weiteren Akteur*innen und Fachpersonen aus der Community.
Dieser Beitrag ist erschienen in der SOZIOkultur 4/2023 Digitalität
Vertraute Orte neu entdecken, geheime Geschichten lüften und vergessene Persönlichkeiten treffen – das ermöglicht die „Psst!-WebApp“ der Schaubühne Lindenfels: eine faszinierende Reise durch die Zeit und ein interaktives Erlebnis, das die Grenzen zwischen Fiktion und Realität hinterfragt.
In einer Zeit, in der sich Kultur im Digitalen neu verorten muss, hat die Schaubühne Lindenfels in Leipzig einen wegweisenden Schritt unternommen, ihre Bühne in den digitalen Raum zu erweitern. Mit „WebApp Psst!“ können User*innen seit letztem Jahr in der Zeit vor- und zurückreisen und vermeintlich vertraute Orte neu entdecken. Dabei begegnen sie einzigartigen Persönlichkeiten und deren Geschichten.
Mit einem mobilen Endgerät lässt sich die Anwendung von überall starten. Der Chat führt einen direkt zu markanten Orten Leipzigs oder gar in die Schaubühne selbst. Anhand von Bildern, Audiodateien und bald auch Videos können User*innen historischen und fiktionalen Persönlichkeiten begegnen, die sie in die Geschichte in und um Leipzig von 1645 bis heute mitnehmen. Wer war eigentlich Lou von Salomé und welche Verbindung hatte sie zu Nietzsche? Und wusstet ihr, dass es eine Leipziger „Hamlet-Uraufführung“ von 1645 gibt?
Das Konzept für die „Psst!-WebApp“ entstand zu Beginn der Corona-Pandemie als Antwort auf die Herausforderungen, denen sich die Kulturlandschaft gegenübersah. Die Schaubühne Lindenfels mit der Projektverantwortlichen Sara Holitschke und der Produktionsfirma für interaktives Storytelling Theadeus Roth und ihrem Geschäftsführer Dennis Levin will damit Geschichte und Kunst für jeden erlebbar machen und neue Erzählräume öffnen. Die Anwendung öffnet nicht nur eine neue Dimension von Theater, sondern ermöglicht immersiv die Verbindung von Kulturgeschichte und Kunst, von Gestern und Heute, von Fiktion und Realität – mit dem Anspruch auf eine in sich stimmige und stringente Rahmenhandlung. Die Schaubühne erforscht mit diesem Projekt die Frage, wie Soziokultur und Theater im digitalen Raum einen Ort finden können, an dem analoge und digitale Bühne einander nicht ersetzen, sondern sich symbiotisch ergänzen, um Geschichten partizipativ zu erzählen.
Die App verbindet Geschichte und Kunst, Gestern und Heute, Fiktion und Realität.
Trotz des Starts während der Pandemie wurde die „Psst!- WebApp“ durch ihren modularen Aufbau erweiterbar gestaltet. Ein Update im Oktober 2023 verbessert die technische Performance und ermöglicht die Nutzung der App auf allen internetfähigen Endgeräten – dann auch ohne Anmeldung.
Die Entwicklung der App erfolgte im Rahmen von „dive in. Programm für digitale Interaktionen“ der Kulturstiftung des Bundes und KULTUR.GEMEINSCHAFTEN, der Kulturstiftung der Länder, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Programm NEUSTART KULTUR.
Dieser Beitrag ist erschienen in der SOZIOkultur 4/2023 Digitalität
Die Versammlungsstättenverordnung VStättVO § 43 legt fest: „Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber ein Sicherheitskonzept aufzustellen.“ Bei außergewöhnlichen, sehr aufwändigen Veranstaltungen innerhalb der eigenen Versammlungsstätte oder bei größeren Außer-Haus-Veranstaltungen, die ein gewisses Gefährdungspotential mit sich bringen, wird ein Sicherheitskonzept gefordert. Dieses Konzept muss bei einem Genehmigungsverfahren auch den entsprechenden Behörden vorgelegt werden.
Veranstaltungen detailliert beschreiben
Dieses Konzept muss die Örtlichkeit sowie Art und Ablauf der Veranstaltung beschreiben. Die verantwortlichen Personen müssen benannt werden und Zuständigkeiten müssen exakt bezeichnet sein. Es müssen Angaben zu Rettungswegen, Besucher*innenlenkung, Notfallkonzepten, ggf. verkehrsrechtlichen Anordnungen und Zutrittsbeschränkungen gemacht werden. Infrastruktur, Toilettenanlagen, Wasserversorgung, Brauchwasserentsorgung und alle für die Veranstaltung zutreffenden Problemstellungen müssen behandelt werden. Oft fallen auch Statische Bauabnahmen für Bühnen / Aufbauten, Sicherheitsdienste, Sanitätsdienste etc. darunter.
Hilfestellung: Muster nutzen!
Diese Auflistung ließe sich fortsetzen, da gerade Open-Air-Veranstaltungen aufgrund der konkreten Gegebenheiten vor Ort sehr individuell behandelt werden müssen. Eine gute Hilfestellung stellt die Handreichung des Innenministeriums aus NRW und das darin enthaltene Muster-Inhaltsverzeichnis der Düsseldorfer Feuerwehr dar. Hier werden alle infrage kommenden Punkte für ein Sicherheitskonzept aufgelistet und es können die für die eigene Veranstaltung relevanten Aspekte herausgefiltert werden.
___________________
Text: Thomas Schiffmann ist Technischer Betriebswirt sowie Meister für Veranstaltungstechnik und arbeitet in der Stabsstelle der Geschäftsführung im Kulturzentrum E-Werk, Erlangen. Für den Bundesverband Soziokultur e. V. führt Thomas Schiffmann regelmäßig Seminar zur Veranstaltungssicherheit durch. Die Teilnehmenden erhalten das Zertifikat „Aufsicht führende Person“.
Die Digitalität bietet neue ästhetische Räume für die kulturelle Bildung. Das Team des Köşk will diese gestalten. Zu Besuch bei einem Workshop, bei dem Realität und Virtualität verschwimmen.
Ein Beitrag aus dem Magazin SOZIOkultur zum Thema Digitalität
Orangefarbene Schalenstühle ohne Beine schweben im Raum. Weiße Löcher klaffen in den neon-bunt bemalten Wänden und im grau-braunen Estrich-Boden. Der Raum dreht sich, als Aida mit dem Finger über den Bildschirm des Tablets streicht. „Wir dokumentieren das Köşk mit einer 3D-App, weil es bald abgerissen wird.“ Aida ist Medienkünstlerin und leitet diesen Workshop, dessen Teilnehmer*innen mit Tablets in der Hand den 200 Quadratmeter großen Raum des Jugendkulturzentrums im Münchner Westend scannen und in ein 3D-Modell verwandeln. „Das ist wie bei Pokémon Go“, meint Antonia, als sie mit dem Tablet durch den Raum läuft und dabei versucht, jedes Detail der Einrichtung zu erfassen. Nach und nach füllen sich die Löcher in den Wänden, Stühlen und Tischen wachsen Beine.
„Ich bin unter den Tisch gekrochen“, erzählt Antonia mit einem schon ein sehr detailliertem 3D-Abbild des Köşk in der Hand. Pedram hat sich die Bar am Eingang vorgenommen. Die gelb-weißen Gerbera-Sträußchen in den zwei Limo-Flaschen auf dem Tresen werden ebenso digitalisiert wie die Getränkekästen neben der blassgrünen, zu einem Garten geöffneten Eingangstür. Diese erinnert, wie die bodentiefe Fensterfront, vor der eine lange, mit bunten Stofffetzen geschmückte Rollstuhlrampe entlangführt, an die ehemalige Nutzung des Flachbaus als Stadtbibliothek.
Realer Ort für alle
Andrea, die künstlerische Leiterin des Köşk, steht vor der Eingangstür, hinter ihr flattern die bun- ten Stofffetzen an diesem wechselhaften windigen Julitag. „Das Köşk ist ein großer Raum, wie ein Schaufenster. Ein Freiraum, wo die unterschiedlichsten Leute kommen und ihre Ideen umsetzen können.“ In den vergangenen neun Jahren hat sie gemeinsam mit Projektleiterin Julia Ströder und ihrem Team aus dem Zwischennutzungsprojekt unter dem Slogan „Bis zum Rausschmiss…! Wir machen Platz für junge Kunst- und Kulturprojekte!“ einen beliebten kulturellen Treffpunkt für das Viertel entwickelt. Junge Künstler*innen stellten dort aus, in den Werkstätten konnte mit den unterschiedlichsten Materialen und Medien experimentiert werden, das Community-Orchester und der Köşk-Chor luden alle Generationen zum gemeinsamen Musizieren ein. „Wir haben hier viele Obdachlose“, sagt sie und deutet auf den Garten, dessen Mittelpunkt ein von Bänken umkreister ausladender Baum bildet und von dem aus Besucher*innen über fünf genoppte Stahltreppenstufen das Köşk betreten können. „Sie kommen zu uns rein, spielen Klavier oder hören einem Konzert zu. So entstehen Begegnungen, die es sonst nicht gibt.“ Das Köşk war ein Ort für alle, den es bald nicht mehr gibt. In wenigen Tagen steigt das letzte Abrissfest. Danach ist Schluss im Köşk.
Besucher*innen kommen rein, spielen Klavier oder hören einem Konzert zu. So entstehen Begegnungen, die es sonst nicht gibt.
Aida will den Abriss digital begleiten. Nicht nur der Raum, den die Workshop-Teilnehmer*innen heute abscannen, auch die wetterschützende Platane im Garten, unter der vor ein paar Tagen noch eine Brass-Band Anwohner*innen zum Tanzen und Feiern animierte, soll für die Nachwelt digital erhalten bleiben. Wie der haushohe Baum allerdings eingescannt werden kann, weiß Aida noch nicht, sie will es an einem anderen Tag mit einer Drohne probieren.
Digitaler Baum im Raum
Welche kreativen Möglichkeiten das Digitale bietet oder „the magic“, wie Aida es nennt, demonstriert sie an Antonias Tablet. Mit einem Klick erscheint auf dem Tablet das eingescannte 3D-Modell im realen Raum. Aida kann das 3D-Modell beliebig versetzen, drehen, größer und kleiner machen. Augmented Reality (AR), also eine Erweiterung der Realität, nennt sich diese Technik, die zum Beispiel auch bei Fußballübertragungen zum Anzeigen von Entfernungen bei Freistößen zum Einsatz kommt. „Wir könnten auch den Baum von draußen einfach hier reinsetzen“, sagt die examinierte Künstlerin, der wie allen im Köşk der totgeweihte Baum sehr am Herzen liegt.
Extended-Reality-Workshops
Der Baum spielte auch schon in einem anderen Digital-Workshop eine zentrale Rolle. Kinder und Jugendliche lernten mit einer visuellen Programmiersprache, einem sogenannten Blockcode, mit der schon Grundschüler*innen coden lernen können, eine Geschichte in einer digitalen Umgebung zu programmieren. Held der Geschichte ist besagter Baum. Er flieht, sobald sich ihm die Holzfäller*innen nähern – im Gegensatz zur Realität mit Erfolg. Auch hier lassen sich die Protagonist*innen aus der digitalen Umgebung mittels AR in die reale Welt versetzen oder per Virtual Reality (VR) in ihrer digitalen Welt in 3D besuchen. Die Idee zu den Extended-Reality-Workshops (XR) hatte Aida während der Pandemie, als es darum ging, Angebote für Kulturvermittlung zu entwickeln, die auch von zu Hause aus funktionieren. Über NEUSTART KULTUR schafften sie sich Tabletts, VR-Brillen und Software an. Das Team sowie Kinder und Jugendliche der Digital-Community des Köşk erhielten eine Schulung im Umgang mit der neuen Software und Technik. In den eigenen vier Wänden konnten sie dann mit den virtuellen Räumen experimentieren.
Held der Geschichte ist der Baum. Er flieht, sobald sich ihm die Holzfäller*innen nähern – im Gegensatz zur Realität mit Erfolg.
„Mittlerweile versuchen wir, Jugendliche dazu auszubilden, selbst Workshops zu geben, denn die sind die Profis in diesen digitalen Welten“, erzählt Andrea, deren Welt die Fotografie ist. Sie selbst sei eine „Niete in diesen Sachen“ doch fasziniert von den Möglichkeiten: „Es ist schon wahnsinnig cool, was diese Technik für neue Erlebnisse schafft.“ So erinnert sie sich gerne an einen großen Moment der Entzückung, als eine ältere, fast erblindete Workshopteilnehmerin durch eine VR-Brille Fische vorbeischwimmen sah und begeistert ausrief: „Ach, dass ich noch einmal Fische sehen kann.“
Digitalität und Empowerment
Die Digitalität schafft neue ästhetische Erfahrungsräume für die kulturelle Bildung, die generationenübergreifend erlebt und gestaltet werden können. Die Beschäftigung mit diesen Räumen, das Wissen über deren technische Funktionsweise versetzt gestaltende Nutzer*innen in die Lage, sich kritisch mit den digitalen Medien auseinanderzusetzen – für die Workshopleiterin ein zentraler Punkt ihrer Arbeit: „Nur derjenige, der weiß, wie Sachen funktionieren, kann auch kreativ damit arbeiten, kritisch das Ganze beobachten und selber bessere Lösungen anbieten.“ Insbesondere Kinder und Jugendliche sollen dabei lernen, dass sie nicht nur Nutzer*innen digitaler Medien sind, sondern diese aktiv gestalten können. „Wenn sie dieses Gefühl gegenüber der realen Welt um sich herum haben, fangen sie erst an, darüber nachzudenken, wie diese gestaltet werden soll.“ Digitalität und Empowerment – ein Paar für die Zukunft. Der 20-jährige Pedram hat durch die Digital-Workshops Interesse an der Gestaltung virtueller Welten gefunden. Aida empfiehlt ihm und allen, die sich intensiver mit dem Coden auseinandersetzen wollen, Kurse US-amerikanischer Universitäten wie die des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Diese können im Internet kostenlos heruntergeladen und durchgearbeitet werden.
„Was wir damit machen, überlegen wir uns noch“, sagt Aida, als der Workshop vorüber und der Innenraum des Köşk vollständig eingescannt ist. Das Team, die Anwohner*innen und die Besucher*innen müssen sich nun von ihrem Kulturtreff verabschieden. In der realen Welt wird anstelle des Zwischennutzungsprojekts ein mehrstöckiger, vielfältig genutzter Neubau für den Kreisjugendring München-Stadt, den Träger des Köşk, errichtet. Doch die engagierten Münchner*innen haben nicht allzu weit entfernt einen neuen Ort gefunden. Den alten können sie dann virtuell besuchen.
Dieser Beitrag von Prof. Dr. Tobias Hochscherf und Prof. Dr. Martin Lätzel ist erschienen im Magazin SOZIOkultur zum Thema Digitalität.
Was passiert eigentlich gerade? Die Medien verändern das Zusammenleben und das Selbstverständnis der Menschen maßgeblich. Die digitale Transformation ist nicht mehr von den rasanten Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz (KI) zu trennen. Während soziokulturelles Engagement Machtverhältnisse infrage stellt und herrschaftskritisch orientiert ist, haben wir es mit Technologien zu tun, die dazu geeignet sind, Einfluss zu konzentrieren und Ohnmacht angesichts technischer Entwicklungen zu befördern.
Status Quo: Historisch keine Neuigkeit
Dies ist geschichtlich eigentlich nichts Neues. Der Einfluss von Technik und Medien wurde in der Medienkulturwissenschaft vielfach beschrieben – häufig mit einem negativen Unterton. So zeichnete der Philosoph und Anthropologe Arnold Gehlen ein düsteres Bild des zunehmenden Einflusses der Technik. Er fasst diesen Einfluss als Prozess in drei Stufen auf.
„Auf der ersten Stufe, der des Werkzeuges, werden die zur Arbeit notwendige physische Kraft und der erforderliche geistige Aufwand noch vom Subjekt geleistet. Auf der zweiten Stufe, der der Arbeits- und Kraftmaschine, wird die physische Kraft technisch objektiviert. Schließlich wird auf der dritten Stufe, der des Automaten, auch der geistige Aufwand des Subjekts durch technische Mittel entbehrlich gemacht.“
Der Kybernetiker Gregory Bateson stellte zu Beginn der Achtzigerjahre angesichts der technologischen Entwicklung fest, „bewußte Zwecksetzung hat nun die Macht, das Gleichgewicht des Körpers, der Gesellschaft und der biologischen Welt um uns herum über den Haufen zu werfen. Eine Krankheit – ein Verlust des Gleichgewichts – kündigt sich drohend an“.
Aktuell begegnen sich diametrale Gegensätze: Soziokulturelles Selbstverständnis und nicht demokratisch legitimierte Tech-Giganten
Wir stehen schwankend und zweifelnd vor einer neuen, bedrohlich wirkenden Unübersichtlichkeit. Während es bisher vor allem menschliche Entscheidungen, ökologische und ökonomische Rahmenbedingungen sowie politische Wertesysteme waren, die einen entscheidenden Einfluss auf die Soziokultur hatten und haben, sehen wir aktuell eine wachsende gesellschaftliche (und ökonomische) Steuerung durch nicht demokratisch legitimierte Tech-Giganten. Das soziokulturelle Selbstverständnis steht dem diametral entgegen. Uns geht es hier um die Frage, ob die Nutzung digitaler Werkzeuge in Einklang zu bringen ist mit dem Gemeinwohl und der freiheitlich demokratischen Grundordnung.
Es geht um die Frage, ob die Nutzung digitaler Werkzeuge in Einklang zu bringen ist mit dem Gemeinwohl und der freiheitlich demokratischen Grundordnung.
Was sich bei Gehlen – und teilweise bei Bateson – noch beunruhigend geriert, hörte sich bei Marshall McLuhan, einem Hauptvertreter der Schule von Toronto, versöhnlicher an. McLuhan ging davon aus, dass Medien als Träger von Information die Beziehungen der Menschen zueinander und zu sich selbst verändern: „So zielen beispielsweise mit dem Aufkommen der Automation die neuen Formen menschlichen Zusammenlebens bestimmt auf die Abschaffung der Routinearbeit, des Jobs hin. Das ist das negative Ergebnis. Auf der positiven Seite gibt die Automation Menschen Rollen, das heißt eine tieferlebte Beteiligung der Gesamtperson an der Arbeit und der menschlichen Gemeinschaft, welche die mechanische Technik vor uns zerstört hatte“.
Mag es bei belanglosem Tun egal sein, ob der Mensch durch die Technik ersetzt wird, so sieht dies beim künstlerischen Prozess anders aus, erst recht, wenn er wie in der Soziokultur wertegeleitetet ist.
McLuhans Gedanken sind durch den Einsatz KI-gestützter Automation aktueller denn je. Sie werden herangezogen, um entweder den Verlust von Eigenständigkeit und Arbeitsplätzen anzuführen, die vollständige Machtübernahme von Robotern und Hyperintelligenzen (wie aktuell der siebte Teil von „Mission Impossible“ zeigt), das Ende der Kreativität anzukündigen oder zu betonen, dass die Maschinen den Menschen neue Freiräume ermöglichen, indem sie von repetitiven und anspruchslosen Tätigkeiten entbunden oder unterstützt und neue Möglichkeiten für die Kunst generiert werden. Mag es bei belanglosem Tun gegebenenfalls egal sein, ob der Mensch durch die Technik ersetzt wird, so sieht dies beim künstlerischen Prozess anders aus, erst recht, wenn er wie in der Soziokultur wertegeleitetet ist.
Folgen für die kulturelle Infrastruktur
Die Kultur ist kein hermetisch abgeschlossener Raum und die technischen Umwälzungen sind auch hier spürbar. Man denke etwa an die aktuelle Diskussion um die Autor*innenrechte von Texten, Tönen oder Bildern, die von generativen KI-Systemen erstellt sind und die mit den Versatzstücken anderer Urheber arbeiten. Neue Techniken betreffen Kultureinrichtungen auf vielfältige Art und Weise: in der Verwaltung, bei der Gewinnung neuer Fachkräfte, in Marketing und Kulturkommunikation, bei Präsentation und Personalisierung von Kultur und bei der Schaffung von Kunst.
Soziokulturelle Einrichtungen sind prädestiniert für die Auseinandersetzung mit KI: Sie können dezentral und in Zusammenhängen denken
Ein Aspekt macht Kultureinrichtungen zu einem prädestinierten Ort für die Auseinandersetzung mit neuen Formen der Digitalisierung und KI: Sie genießen ein hohes Vertrauen und können sich kritisch mit den Chancen und Risiken der Technik beschäftigen. Vor allem haben sie, und das ist ein dezidierter Wert der Soziokultur, das Vermögen, dezentral und systemisch, also in Zusammenhängen zu denken. Wir erinnern uns an Batesons Plädoyer für eine integrierte Betrachtung, die Komplexität erkennt und zur praktischen Steuerung von KI verhelfen könnte: An den Orten der öffentlich geförderten Kultur will einem – im Gegensatz zu den großen globalen Technikkonzernen und zahlreichen Neugründungen in diesem Bereich – niemand etwas verkaufen, es soll keine Meinung vermittelt oder eine bestimmte Lesart vorgegeben werden. Im Zentrum steht Sinngebung, selbst wenn Kunst ohne Zweck ist. „Für die menschliche Vernunft ist es wesentlich, dass sie in allem Sinn finden kann, was ihr begegnet.“ (Friedrich 2023).
Soziokulturelle Orte sind gut beraten, sich selbst zu verhalten, für neue Formate zu öffnen und den Umgang mit KI am konkreten Beispiel auszuprobieren, um einen reflektierten Raum für die kritische Beschäftigung zu bieten.
Nimmt man den Begriff der vertrauenswürdigen KI ernst, dann sind Kultureinrichtungen neben der Bildung zentral, da sie eine für die gesellschaftliche Entwicklung sinnstiftende Auseinandersetzung in einem öffentlichen und geschützten Raum anbieten. „Wir befinden uns,“ so der Medienwissenschaftler Andreas Sudmann, „in einer signifikanten Phase des Übergangs und der Neubestimmung dessen, was Computer im 21. Jahrhundert leisten können. Dies erfordert […] nicht nur einen historischen Zugriff, sondern eben auch eine genaue empirische Beobachtung der Felder hinsichtlich der Anwendung der KI und es erfordert ein neues Nachdenken über kritische beziehungsweise medienkritische Interventionen. Letztere Anstrengungen können sich aber nicht nur auf den Bereich des Technologischen beschränken, sondern wir müssen in der Tat auch reflektieren, wie sie sich auf eine Kritik der Gesellschaft als Ganzes und das Denken in ihr beziehen lassen […].“ Für Sudmann gehören dazu die Ideologiekritik, Gender und Queer Studies sowie die post- und dekoloniale Kritik. Soziokulturelle Orte sind gut beraten, sich selbst zu verhalten, für neue Formate zu öffnen und den Umgang mit KI am konkreten Beispiel auszuprobieren, um einen reflektierten Raum für die kritische Beschäftigung zu bieten.
Kultur als öffentliches Labor für Digitalisierung und KI
Soziokulturelle Zentren und Initiativen können gerade angesichts von krisengetriebener Transformation ihre Anschlussfähigkeit für kritisches und systemisches, demokratie- und teilhabeorientiertes Denken unter Beweis stellen. Kunst wird nicht obsolet, sie erweitert ihren Möglichkeitsrahmen und vor allem auch ihre Teilhabemöglichkeiten (ganz im Sinne der Soziokultur), wie der Künstler Vladimir Alexeev betont:
„Neu […] ist, dass zunehmend Werke in Kooperation zwischen Mensch und Maschine entstehen. Das braucht ganz neue handwerkliche Fähigkeiten. Und die Ausdrucksweisen erweitern sich, es gibt neue Wege, mithilfe von Prompts bestimmte Texte, Bilder oder Musik entstehen zu lassen, auch wenn man nicht malen oder komponieren kann. Die lassen sich mit traditionellen Genres verbinden oder es entstehen ganz neue Dinge.“
Bei aller kritischen Betrachtung können wir schlussendlich hoffen, dass in der Kybernetik auch das Mittel angelegt ist, eine neue und vielleicht menschliche Weltanschauung zu erreichen, ein Mittel, „unsere Philosophie der Macht zu verändern, und ein Mittel, unsere eigenen Dummheiten in einer größeren Perspektive zu sehen“ (Bateson 1981). Es liegt an uns, ob wir den Weg beschreiten wollen, mithilfe von Technik die Welt zu gestalten und zu verändern, oder ob wir uns der Bequemlichkeit hingeben wollen.
Literatur/Quellen
- Vladimir Alexeev: Wir sind am Anfang einer neuen Kulturepoche ZEIT online vom 2. Oktober 2023
- Gregory Bateson: Ökologie des Suhrkamp, Frankfurt 1981
- Jörg Phil Friedrich: Degenerierte Künstliche Intelligenz und die Natur des Denkens. Claudius, München 2023
- Arnold Gehlen: Die Seele im technischen Sozialpsycho- logische Probleme in der industriellen Gesellschaft. Rowohlt, Rein- bek 1969, S. 19. Zitiert nach Günter Helmes und Werner Köster (Hg.): Texte zur Medientheorie. Reclam, Ditzingen 2018, S. 222
- Tobias Hochscherf, Martin Lätzel: KI statt Personal – Fachkräfte- mangel und Innovationsdruck als Herausforderung für Kultur- Kultur Management Network Magazin 172, Mai/Juni 2023, S. 79-88.
- Marshall McLuhan (1964): Understanding The Extensions of Man. Übersetzung von Meinrad Amann für die deutsche Erstausgabe Die magischen Kanäle. Econ-Verlag, Düsseldorf 1992. Zitiert nach Günter Helmes und Werner Köster (Hg.), Texte zur Medientheorie. Reclam, Ditzingen 2018, S. 232.
- Nassim Nicholas Taleb: Antifragilität: Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen. Albrecht Knaus Verlag, München 2013
Im Kulturzentrum Nellie Nashorn in Lörrach beschleunigte die Coronapandemie den Prozess der Digitalisierung. Ging es zunächst um eine zeitgemäße IT-Infrastruktur, ermöglichten die vielfältigen Förderprogramme eine Investition in die digitale Zukunftsfähigkeit: Es wurde in Licht-, Ton- und Videotechnik investiert, aber auch in Glasfaserleitungen, ein modernes Kassensystem und gute Bedingungen für dezentrales Arbeiten. Die Technik sollte dabei in den unterschiedlichen Kontexten unkompliziert als Werkzeug für kreative Prozesse nutzbar sein.
Kreativ war auch der Ansatz für Veranstaltungen mit eingeschränkter Besucher*innenkapazität: Das Publikum teilte sich auf mehrere Räume auf und die Künstler*innen wechselten dazwischen. Ihr Auftritt wurde live in die jeweils anderen Räume übertragen. So verbanden sich Live- und virtuelles Erlebnis. Das hybride Setting forderte von Publikum und Künstler*innen viel Flexibilität und Spontaneität, war aber von Begegnung und starker Interaktion geprägt.
Text: Matti Kunstek
Dieser Beitrag ist erschienen in der SOZIOkultur 4/2023 Digitalität